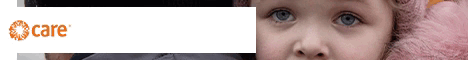- HOME
- START
- NACHRICHTEN
- Glaube, Liebe, Hoffnung
- "Die andere Heilige Woche" - DOMRADIO.DE blickt in Dokumentation auf die Corona-Pandemie zurück
- Zuversicht schenken“
- „Beten mit den Füßen“
- Kreuzweg mit dem Drahtesel entdecken
- Künstlerische Auseinandersetzung mit Trinität
- Bischof Ackermann lädt zu Gewissenerforschung mit der Passionsgeschichte ein
- JO Cooper: Songs mit ganz viel Seele
- Inklusion ist Menschenrecht!
- Das Osterfest 2025 auf DOMRADIO.DE digital mitfeiern
- Zahlen der Jugendabteilung im Bistum Trier sprechen deutliche Sprache: Kirche und Jugend – stabil oder „Aura minus 1.000“?
- Prävention im Bistum Trier: kreativ, vernetzt, zielgruppenorientiert
- Im Einsatz für die gute Sache
- Bischof Dr. Franz Jung nimmt UKAM-Gutachten entgegen
- Zum 80. Todestag von Dietrich Bonhoeffer – ein Gespräch zwischen Heinrich Bedford-Strohm und Dietmar Merz
- Abenteuer und Rätselspaß
- Roland Kaiser wird Botschafter der World Transplant Games 2025 in Dresden
- Auf den Spuren einer Heiligen
- 320 Mitarbeiterinnen der Kita gGmbH Trier treffen sich zum Austausch in Föhren
- Beratungen über Zukunftsperspektiven - Pommersche Kirchenkreissynode tagte in Züssow
- Kirche im Umbruchsprozess
- Berittene Botschafter der Osterfreude
- Digitales Format zur Liturgie von Gründonnerstag bis Fronleichnam - am Sonnabend, 5. April
- Neue Notschlafstelle für Frauen des SkF:„ELLEfriede“ will Frauen in Wohnungsnot einen Schutzraum bieten
- Aufruf zur Unterstützung der Misereor-Fastenaktion 2025 : „Auf die Würde. Fertig. Los!“
- Auf die Würde, fertig, los: Misereor Gast zu Besuch im Bistum Trier
- #Lebenszeichen: Pilger*in der Hoffnung werden!
- 3E wird zu 3E Plus
- Kein Publikum, sondern Teil der Kirche
- Wenn zur Halbzeit nur 6 Cent übrig sind
- Meilenstein in theologischer deutsch-bolivianische Zusammenarbeit
- „Das ist eure Kirche, erobert sie, entdeckt sie!“
- Noch bis 19. April führt die „junge bühne auersmacher“ die Passionsspiele auf: Bewegende Inszenierung voller Tiefe und Emotionen
- Eine echte Nummer!
- „Unglaublich: Ich glaube!“
- Außenausstellung "Zwischen Krieg und Hoffnung" am Mahnmal St. Nikolai
- „Ein Katholikentag, der Mut machen soll“
- Philosoph Christian Pietsch lädt Koblenzer zu Gedankenexperiment ein: Der Ursprung des Bösen
- Konzentration auf den Neuanfang
- Auf Tuchfühlung
- Mit dem Tiny House durch das Bistum Trier: Startschuss für Mini-Kirche auf Rädern
- Neue Dokumentation über verfolgte Geistliche und Ordensangehörige im Nationalsozialismus vorgestellt: Nicht in Gottes Namen
- Kloster Mehrerau lädt zur Einsegnungsfeier der Abteikirche
- „Nationalismus tötet viele Christen“
- 19-Jährige aus Trier arbeitet an einer Grundschule in dem baltischen Land
- Trost suchen bei der „Schmerzhaften Mutter“
- Evangelisch-katholische TelefonSeelsorge Saar feierte 50-jähriges Jubiläum: Seit 50 Jahren an der Seite der Ratsuchenden
- Plattform bietet Unterstützung bei jugendrelevanten Themen: Neue Website der Lebensberatung für Kinder und Jugendliche
- Sanitätsdienst in Rom: Dienst im Sinne des Leitsatzes
- Frauen in Leitung müssen Sichtbarkeit einfordern
- Deutsche Bischofskonferenz veröffentlicht Zahlen: Mehr Frauen in kirchlichen Leitungspositionen
- Karl Kübel Preis geht an Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal und ihre Familie
- Heiliges Jahr in Rom bildet in der Frühjahrausgabe des Magazins „der pilger“ das Schwerpunktthema
- Misereor-Hungertuchwallfahrt startete in Neuwied : „Gemeinsam träumen – Liebe sei Tat“
- Vortragsreihe: Gemeinsam für starke Kinder
- Inklusiver Karneval:Eine magische Nacht im Zirkus
- Bistum Trier: Veranstaltungen befassen sich mit 1.700 Jahre Konzil von Nizäa: „Unglaublich: Ich glaube”
- Neue Initiative im welt:raum: Begegnung ist der Schlüssel
- Weltgebetstag: Nordkirche beteiligt sich an internationaler Friedensbewegung
- Kurs setzen. Neue Horizonte entdecken! - Jetzt für den „Bonifatiuspreis für missionarisches Handeln in Deutschland“ bewerben
- Wie sieht die „nächste Kirche“ aus?
- Als „weltwärts“-Freiwillige im Partnerbistum Mbinga: „Es war die beste Entscheidung“
- Ehrenamtliches Engagement setzt Zeichen der Solidarität und der Hoffnung in schwierigen Zeiten: Menschlich bleiben
- Katholische und evangelische Gemeinde bieten kostenlose Mahlzeit und offenes Ohr
- Wenn Kirche persönlich wird
- Dackel Chillie macht gute Laune
- Eine Kirche als „happy place“
- Nordkirche wählt Anja Fährmann zur Präses
- Caritasverband Koblenz öffnet Türen in 50 Beratungsdiensten und Einrichtungen
- „Kirche in Not“ gibt neuen „Glaubens-Kompass“ über die heilige Hildegard von Bingen heraus
- BONI-Bus gibt es jetzt auch mit Elektro-Antrieb
- Woche der Inklusion: Zum ersten Mal im Bistum Trier
- Passionsspiele finden seit mehr als 100 Jahren statt : Riedener halten ihre Tradition wach
- missio kritisiert Hungerlöhne in Kosmetik-Minen
- Freiwillige Vici Backes kümmert sich um Kinder in Indien: „Ich werde dankbarer sein für das, was wir haben“
- Für das Leben. Bis zuletzt.
- Teensmag gewinnt digital an Zuwachs
- Seelsorge zwischen Räucherforelle und Rostwurst
- "Theo Talk": Den Herausforderungen stellen
- Erlös der Paulinus-Weihnachtskarte stärkt wohnungslose Frauen: Ein geschützter Raum
- Zum Weltkinderkrebstag 2025: Jungen Menschen Hoffnung schenken
- Das Leben wieder lieben lernen!
- Medienapostolat der Steyler Missionare trauert um Redaktionsleiterin Katja Burghardt
- 20 Jahre P&S – Magazin für Psychotherapie und Seelsorge
- Krise als Berufsalltag: Caritas international
- Singfreizeit für Familien und Einzelpersonen: Gemeinsam Singen und Spaß haben
- Selbstexperiment während der Fastenzeit: Reicht es zum Leben?
- Engagement gegen Einsamkeit und Altersarmut: ROSSMANN und Malteser starten Spendenkampagne
- Klima- und Umweltschutz ist Ausdruck von Solidarität
- Diskussion über „Ethik und KI” in der Trierer St. Gangolf-Kirche : „Entscheidung braucht personale Verantwortung”
- Musikalische Lesung: Anne Frank und die Mädchen aus Theresienstadt
- Der Wissenschaft Fulminantes gespendet
- „Furcht ist nicht in der Liebe“
- Jugendliche engagieren sich für Wohnungslose
- Gemeinsam einstehen für Menschenwürde und Toleranz
- DKMS zum Weltkrebstag: Kosmos Stammzellspende – kleine Zellen, große Hoffnung
- 24-Stunden-Lesung in Saarbrücker Synagoge: Annäherung an das Unvorstellbare
- Gebetswoche für die Einheit der Christen 2025: „Glaubst Du das?“
- „Das Recht auf Leben ist nicht verhandelbar“
- Langer Atem – die Ukrainehilfe der Malteser im Bistum Trier
- 80. Todestag von Nikolaus Groß: Widerstand aus tiefem Glauben heraus
- Engagemententwickler*innen im Bistum Trier: Qualitätsmanagement für das Ehrenamt
- Zwei neue Studienleiter verstärken die Evangelische Akademie Loccum
- Jubiläum im Grünen - „Offene Kapelle“ in Jager feiert zehnjähriges Bestehen
- „Doppelwesen” zwischen weltlicher und geistlicher Macht
- Allianzgebetswoche 2025: Hoffnung, Band des Friedens und „Fokus auf Jesus“
- 15 viel zu lange Jahre seit Aufdeckung sexualisierter Gewalt am Canisius-Kolleg
- Erfolgreich gegen das Alleinsein
- Caritas Journalistenpreis 2024 geht an Wolfgang Bauer
- Bonifatiuswerk unterstützt Projekte mit elf Millionen Euro
- St. Marien ist „Pfarrei der Woche“: Radio Horeb überträgt Heilige Messe aus Bleialf live
- Kirchenleitung beruft Propst Marcus Antonioli zum Leiter des Dezernats „Personal im Verkündigungsdienst“
- Der Hausnotruf bleibt beliebt
- Von Ängsten und Träumen
- Königlicher Punsch für alle
- Mehr als 400 Menschen haben sich an der Adventsaktion beteiligt: Projekt „Hoffnungsschimmer“ schafft Verbindung
- Gebet als besondere Gelegenheit, gemeinsam Hoffnung zu erleben und zu teilen
- Jahresprogramm 2025 für die Arbeit mit Frauen in den Kirchenkreisen Mecklenburg und Pommern ist erschienen
- Aus aller Welt
- "Mehr, als wir ertragen können!" - Mitarbeiterin der SOS-Kinderdörfer in Gaza berichtet von Todesangst, Erschöpfung und Verzweiflung
- Kinder werden ungenügend auf die Folgen des Klimawandels vorbereitet
- Massaker am Palmsonntag – 56 Christen in Nigeria ermordet
- Projekt „Trinkbecher für Trinkwasser“: 100.000-Euro-Spendenrekord für sauberes Wasser in Afrika
- Ruanda: Junge Kirche mit Herz für die Jugend
- Eine globale Initiative fördert den Erhalt von Kinderbüchern in bedrohten Sprachen
- Somalia: Drastische Einschnitte bei der Humanitären Hilfe bedrohen das Leben von Kindern und Familien
- Haiti: Bewaffnete Banden ermorden Ordensfrauen
- Global Micro Initiative e.V.: Spendenziel 2024 übertroffen – Vorstand bestätigt
- Syrien: Erzbischof bittet um Aufhebung der Sanktionen
- Sudan: Katholische Hauptstadt-Kathedrale im Bürgerkrieg verwüstet
- Sierra Leone: „Kirche in Not“ finanziert Ausbildung von Priestern in Trauma-Seelsorge
- Good News der SOS-Kinderdörfer weltweit
- Pakistan: Junger Christ attackiert, nachdem er Konversion verweigert hatte
- „Kirche in Not“ unterstützt psychosoziales Zentrum für Christen im Westjordanland
- Nigeria: Zwei Priester entführt
- Kindersterblichkeit in Somalia droht nach Jahren des Fortschritts wieder zu steigen
- Erneute Angriffe auf Gaza setzen Kinder unter Schock
- Nigeria: Kirche schockiert über erstmalige Ramadan-Schulschließungen
- Syrien: Auch Christen unter Opfern der jüngsten Massaker
- Vereinte Nationen rügen iranische Regierung wegen unverhohlener Leugnung der Schändung von Bahá’í-Friedhöfen
- DOK.fest: Die Welt lässt ihre Kinder im Stich, Dokumentarfilmpreis gibt ihnen eine Bühne
- Ukraine: Ein Priester in der Kriegshölle
- Mädchen und Frauen bei der Gesundheitsversorgung extrem benachteiligt - SOS-Kinderdörfer zum Internationalen Frauentag am 8. März
- Waffenstillstand in Gaza hat die Lage für die Christen im Westjordanland verschlechtert
- Bischöfe aus der Zentralafrikanischen Republik: Öffnung gegenüber Russland hat dem Land geschadet
- Drei Jahre Krieg in der Ukraine: Kapellenwohnwägen bringen neue Hoffnung
- Myanmar: Katholischer Priester ermordet
- Bildungslücken ukrainischer Kinder in Frontgebieten immer größer
- Burkina Faso: Erneut Überfälle auf eine Pfarrei mit vielen Todesopfern
- "Selbstwertgefühl im Keller": Kriegsverletzte Kinder in der Ukraine brauchen intensive Unterstützung
- Demokratische Republik Kongo: Lage im Osten des Landes spitzt sich dramatisch zu
- Kenia: Die Engel von Nairobi
- Jetzt für einen weltwärts-Freiwilligendienst in Indien bewerben
- Südsudan: Kinderbibel von „Kirche in Not“ hilft beim Lesen lernen in der Muttersprache
- Estland: Von zehn auf bis zu 10 000 Katholiken in 55 Jahren
- Syrien: Christen zwischen Angst und Normalität
- Demokratische Republik Kongo: Kriegsangst nach Eroberung der Stadt Goma
- Mali: Katholische Schulen vor dem Aus
- Demokratische Republik Kongo: Kirchenvertreter werfen Ruanda Unterstützung von Milizen vor
- Libanon: „Frieden ist noch nicht wiederhergestellt“
- Ständeratskommission unterstützt Friedensforum zum Bergkarabach-Konflikt – Schweiz setzt wichtiges Zeichen der Hoffnung
- „Kirche in Not“ ruft am 1. Februar zum 24-Stunden-Gebet für Myanmar auf
- Waffenruhe in Gaza: Langfristige Unterstützung für Kinder und Familien nötig
- 122 Priester und Ordensleute wurden 2024 ermordet, entführt oder inhaftiert
- Psychische Situation von Kindern durch weltweite Kriege immer schlechter
- Mexiko: „Das Schwerste ist, einem Kind zu sagen, dass sein Vater getötet wurde“
- In Burkina Faso sind Katecheten die „Helden der Kirche“
- Weihnachtsgrüße aus der Ukraine: „Danke, dass Sie uns helfen, Leben zu retten“
- „Großvater“ Papst Franziskus ruft täglich bei Christen in Gaza an
- 2024 - Bedrohungslage für Kinder durch weltweite Zunahme bewaffneter Konflikte immer dramatischer
- Wetterextreme nehmen immer mehr zu und bedrohen das Leben von Millionen Kindern
- Nigeria: „Frieden wahren, statt Vergeltung zu üben“
- Syrien: Erste Kontakte zwischen Christen und Rebellen-Regierung
- Heiliges Land: Lateinischer Patriarch hofft auf baldiges Kriegsende
- Bundespräsidentin Viola Amherd unterstützt die Rechte der Karabach-Armenier – die Schweiz kann jetzt ein Friedensforum zum Bergkarabach-Konflikt organisieren
- YOUCAT-Stiftung stellt sich neu auf
- Haiti: Bischöfe verurteilen in einem „Alarmruf“ die ausufernde Gewalt
- Bilanz zum „Red Wednesday“ 2024: 20 Länder zeigten Solidarität mit verfolgten Christen
- Syrien: „In Aleppo herrscht ein Klima der Angst“
- Ukraine: „Die Menschen sind apathisch und desillusioniert“
- Erneute Kämpfe in Nordsyrien: „Angst macht sich breit“
- Heftige Regenfälle in Gaza: "Jede Stunde zählt jetzt, um noch Schlimmeres zu verhindern"
- Fast jede dritte Frau weltweit von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen
- SOS-Kinderdörfer und HIGH VIEW setzen ein starkes Zeichen für benachteiligte Kinder weltweit
- Internationaler Tag der Kinderrechte am 20. November: Kinder werden zunehmend ihrer Rechte beraubt
- Libanon: Flüchtlingswelle erhöht gesellschaftliche Spannungen
- Kolumbien: Tödlicher Anschlag zerstört kirchliche Gebäude
- Irak: „Kirche in Not“ unterstützt Kindergarten
- 10 Jahre – Global Micro Initiative e.V. feiert eine Dekade voller Chancen und nachhaltiger Veränderung
- Libanon: Ordensfrauen beherbergen über 800 Kriegsflüchtlinge
- Mehr als eine Million Kinder beteten weltweit um Frieden
- Burkina Faso: 150 Menschen während dreitägigem Massaker getötet
- Mehr als die Hälfte aller von Armut betroffenen Menschen sind Kinder
- „Kirche in Not“ startet Millionen-Kampagne für Christen im Libanon
- 25 Jahre nachhaltige Entwicklungshilfe in Kenia
- Dritter Kriegswinter in der Ukraine: Herausforderungen für Kinder und Familien immer größer
- Libanon: Christen nehmen Kriegsflüchtlinge auf
- Bedingungslos auf der Seite der Kinder
- „Kirche in Not“ ruft zur Teilnahme am Gebetstag um Frieden im Heiligen Land auf
- Ein Jahr Krieg in Gaza: Kinder haben alles verloren
- „Der gesamte Südlibanon ist ins Visier genommen“
- „Kirche in Not“ gibt Begleitheft zur heiligen Messe für Kinder heraus
- Chaldäisch-katholisch in Georgien: „Das Christentum ist unsere Kultur“
- Kultur
- „Die Beatrice Egli Show“ am Ostersamstag im Ersten
- Ein Leben in Farbe: Waris Dirie zeigt „Mogadishu Blues“ im Bank Austria Kunstforum Wien
- GARBAGE veröffentlicht Single und Video zu brandneuem Song „There's No Future In Optimism
- Drei ARD Radioproduktionen für Prix Italia nominiert
- Große Landesausstellung Baden-Württemberg 2025 „500 Jahre Bauernkrieg“
- „Adoptivbrüder – mit Hannes & Jeremy“
- Heilig-Rock-Tage Trier bieten buntes kostenloses Kulturprogramm an : Von der Gregorianik bis zur Karibik
- Chamber Music Connects the World: Ein Festival als Gegenentwurf – in Zeiten von Trennung und Spaltung
- Motto: „Bach.familiär“ - Kartenverkauf für 79. Greifswalder Bachwoche hat begonnen
- Mrs. Greenbirds „Hold on“ ab sofort erhältlich – Happy Release Day
- JESSE DANIEL IST DER „SON OF THE SAN LORENZO“
- Ab Donnerstag mit Empfehlung der FBW-Jugend Filmjury im Kino: MIT DER FAUST IN DIE WELT SCHLAGEN, EDEN und VICTORIA MUSS WEG
- Faszination Zollverein: Fotoausstellung präsentiert unverwechselbares UNESCO-Welterbe
- Bundesweite „Nacht der Bibliotheken“
- DON AIREYS neues Album OUT NOW! "Pushed To The Edge" erntet begeisterte Kritiken
- BIG TIME RUSH: In Real Life Worldwide Tour 2025
- Ein Hauch von Tarantino: Two Passengers veröffentlichen Duett "Johnny"
- AVERY ANNA ÜBERWINDET DEN HERZSCHMERZ MIT IHREM NEUEN TRACK „WISH YOU WELL“, DER HEUTE ERSCHIENEN IST
- Kulturprogramm zum 375. Jubiläum des Augsburger Hohen Friedensfest 2025
- Aktueller Kinostart mit Empfehlung der FBW-Jugend Filmjury
- Maja Göpel eröffnet Jahresprogramm der Franckeschen Stiftungen 2025 »Alles in Ordnung?«
- Einflussreiche Alternative Rockband GARBAGE kündigt neues Album an
- Vom Youtube-Star zur Unternehmergröße - Saliha Öczan, alias Sally
- „Höllenrausch – Der große Traum vom Nürburgring“
- DEEP PURPLEs SIMON McBRIDE - Neues Album "Recordings: 2020-2025" - out now!
- Star-Fotograf Anton Corbijn für die eigene Wand: exklusive Edition im Bank Austria Kunstforum Wien
- Gen Z-Gitarristen-Phänomen MARCIN mit Debüt-Album „DRAGON IN HARMONY“ auf Deutschland Tournee
- JAMES ARTHUR: The Pisces World Tour Europe 2025
- Eisbrecher: Neues Album „Kaltfront!“ erscheint am 14. März - Livetermine im Frühjahr
- 45.000 US-Dollar Preisgeld für Natalia Rivera und Jerónimo Reyes-Retana
- PRISON ISLAND kommt nach Berlin: Das ultimative Action-Game-Erlebnis
- Marco Mengoni: Live in Europe 2025
- JETZT IM VERKAUF: MAX McNOWN'S DEBUT UK/EU HEADLINE TOUR DIESEN DEZEMBER
- „Doll zugehört“: MDR JUMP fragt auf mitteldeutschen Marktplätzen, was die Menschen bewegt
- Sitrekin & Humble Choir – Die Stimme hinter dem Twilight-Hit 'Eyes on Fire' Live in Berlin erleben!
- Don Toliver: PSYCHO Tour – Zusatzshows
- Aktuelle Kinostarts mit Prädikat / inklusive Empfehlungen der FBW-Jugend Filmjury
- Ars Electronica Solutions stattet CODE mit Deep Space aus
- Umfassende Einzelausstellung von Mikhail Karikis - Voices, Communities, Ecologies.
- KIP MOORE SCHLÄGT MIT DER VERÖFFENTLICHUNG SEINES UMFANGREICHEN NEUEN ALBUMS SOLITARY STRACKS EIN NEUES KREATIVES KAPITEL AUF
- DON AIREY veröffentlicht "Moon Rising" aus dem neuen Soloalbum "Pushed To The Edge" | VÖ: 28.03.25
- Globalisierung! Die Sonderausstellungen des Jahres 2025 im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg widmen sich einem hochaktuellen und brisanten Thema
- Jessica Schwarz: Ihr Erfolgsrezept als Hotelmanagerin
- „Crunch – Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie“
- PITBULL: Party After Dark Tour
- Tom Jones: Defy Explanation
- DON TOLIVER: PSYCHO TOUR
- MIDLAND KÜNDIGT EUROPATOURNEE FÜR AUGUST 2025 AN
- FINNEAS: For Cryin' Out Loud! : The Tour!
- „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ - Besetzungsliste der Fernsehfastnacht am 28. Februar 2025, 20:15 Uhr im Ersten
- Up-And-Coming Sängerin Chanel Yates kündigt neue Single "Big Girl Boots" an
- LIL BABY: WHAM World Tour
- Hier kommt Nina lädt auf eine musikalische Entdeckungsreise ein mit neuer Single!
- Peter Fox lädt zur „Block Party” in Berlin
- BIG TIME RUSH KÜNDIGT„IN REAL LIFE WORLDWIDE TOUR“ AN
- Deutscher Lesepreis 2025: Zwei Auszeichnungen für besondere Leseförderung in Hessen
- Camila Cabello: Yours, C
- Ab Donnerstag mit Prädikat im Kino: Die in Venedig ausgezeichnete Tragikomödie DER PFAU - BIN ICH ECHT? mit Albrecht Schuch
- BRIT FLOYD: WISH YOU WERE HERE - CELEBRATING 50 YEARS OF PINK FLOYD’S ICONIC ALBUM
- POST MALONE PRESENTS: THE BIG ASS WORLD TOUR
- Der Schlüssel der Träume. Surrealistische Meisterwerke der Collection Hersaint
- ANIMI VOX entfacht mit “FIRE” eine musikalische Revolution
- Happy Release Day! Sotiria mit dem Album "Meine Liebe ist Gift" (Ariola/Sony Music)
- Podcast „OZ. Graffiti-Künstler. Schmierfink. Rebell.“
- Aktuelle Kinostarts mit Prädikat / inklusive Empfehlung der FBW-Jugend Filmjury
- „KLIMTS KUSS – Spiel mit dem Feuer“ nur noch bis zum 29. März 2025 in Mainz
- KENDRICK LAMAR UND SZA IM SOMMER 2025 MIT IHRER GRAND NATIONAL TOUR IN EUROPA UND UK
- SIMON McBRIDE von DEEP PURPLE kündigt neues Album "Recordings: 2020-2025" an
- Veranstaltungen in Celle 2025 – Ein Jahr voller Kultur, Musik, Erlebnisse und zu Ehren einer Königin
- SWR 2025 – nah bei den Menschen im Südwesten
- Lustiges Musikvideo, aktuelles Thema von ELLIS MANO BAND
- Deutschlandpremiere: „Enlightenment“ – die beeindruckende immersive Lichtshow startet heute in der Passionskirche Berlin
- Virtueller 3D-Hörsaal aus Österreich gewinnt Inavation Award in Barcelona
- Tebey veröffentlicht das offizielle Lyric Video für das fesselnde Duett 'Hangover At My Place' mit Tenille Arts
- 15 Jahre „organisiertes Verbrechen“
- Kunstfestival Art on Snow startet mit perfekten Bedingungen in Gastein
- Erfolgreiche Konzertreihe „FreundschaftsSpiele“ an der Kronberg Academy geht in die dritte Runde
- Rauw Alejandro kündigt Europatournee an
- Rund 150.000 sahen die PLAYMOBIL-Ausstellung in Speyer
- JOE SATRIANI, ERIC JOHNSON und STEVE VAI: "G3 Reunion Live" - Jetzt erhältlich bei earMUSIC!
- KIP MOORE TESTET SEINE ÜBERZEUGUNG IN NEUEM SONG „AROUND YOU“
- VIRALE „INDIGO” HIT-SÄNGERIN AVERY ANNA KOMMT ZUM ERSTEN MAL NACH DEUTSCHLAND
- Düstere Klangwelten und metallische Raffinesse: Tonnen von Hall präsentieren ihr Debütalbum!
- David Guetta: The Monolith Stadium Tour 2025
- „MDR für alle“ 2025: Regionale Verankerung vertiefen, mehr Digitalangebote und Dialog mit dem Publikum ausbauen
- Aktuelle Filmstarts mit Prädikat im Kino und Home Entertainment
- Rod Stewart: Live in Concert - One More Time
- Filmfestival Max Ophüls Preis 2025: Ganze Palette menschlicher Erlösungsbedürftigkeit
- MAX McNOWN VERÖFFENTLICHT ZWEITES ALBUM NIGHT DIVING
- IGGY POP "Live At Montreux Jazz Festival 2023" ab sofort weltweit über earMUSIC erhältlich
- SWR / SWR Streaming-Tipps für Februar 2025
- Nordlichter - 26. Januar – 25. Mai 2025
- Nine Inch Nails kündigen Peel It Back Tour 2025 an
- Klavier Nr. 13 am Bahnhof Lichtenberg: Musikalisches Symbol für den Klimaschutz
- STAR WARS Begeisterung in Frankfurt: „The Fans Strike Back®“ begeistert Tausende Fans in Rekordzeit
- Alle Farben trifft den Puls der Nacht mit neuer Single "The Rhythm"
- Die 2000er rufen an: NAIR bringt mit "Sieben Leben" den Retro-Vibe zurück!
- Fertigstellung des Tiefdepots des Germanischen Nationalmuseums mit Festakt begangen
- Ernst Alt – Wanderer zwischen den Welten
- DON AIREY kündigt neues Soloalbum "Pushed To The Edge" an
- Ralph Gleis: „Die ALBERTINA neu denken und neu entdecken“
- Für Zusammenhalt und Kreativität: Magic Bavaria spendet 1.000 € an Artists for Kids
- Jetzt bewerben: Dietrich-Oppenberg-Medienpreis 2025 zeichnet journalistische Beiträge zum Lesen aus
- Aktuelle Filmstart mit Prädikat im Kino / inklusive Empfehlungen der FBW-Jugend Filmjury
- KIP MOORE BEGIBT SICH MIT DEM KOMMENDEN ALBUM SOLITARY TRACKS AUF EINE GROSSE, NEUE REISE
- BLUES-ROCK INSTITUTION ELLIS MANO BAND VERÖFFENTLICHT NEUE SINGLE "COUNT ME IN"
- Letzte Tage: «Matisse - Einladung zur Reise» mit erweiterten Öffnungszeiten
- Aktueller Filmstart mit Prädikat im Kino
- SemperOpenairball 2025: Musik, Tanz und Feuerwerk - im Dreivierteltakt über den Theaterplatz
- S+T+ARTS Prize und S+T+ARTS Prize Africa 2025
- Einreichungen für Prix Ars Electronica 2025 ab sofort möglich
- TAGESZEITEN. CASPAR DAVID FRIEDRICH IN HANNOVER
- Die FBW empfiehlt ausgezeichnete Kinostarts für die kommenden Festtage
- Ein galaktischer Auftakt: STAR WARS Fan-Ausstellung „The Fans Strike Back®“ feiert erfolgreiche Eröffnung in Frankfurt
- SWR Streaming-Tipps für Januar 2025
- JOE SATRIANI "Big Bad Moon" (G3 REUNION LIVE)’: Die neue Single & Video aus dem kommenden Album
- Politik
- Saarländische Landesregierung trifft Bistumsleitungen Speyer und Trier: Land und Kirche als starke Partner
- „Mitbestimmen statt zuschauen: Demokratie in die Hand nehmen!”
- Erfolg und Kontroverse: Film und Podcast über Boris Palmer
- Evangelische Akademie Bad Boll: "Wir stehen für eine demokratische, offene und gerechte Gesellschaft" – Stellungnahme zur Bundestagswahl 2025
- Apotheker rufen zur Wahl auf: Mit "What's Apo" über Gesundheitspolitik vor Ort informieren!
- Position des Familienbundes der Katholiken im Bistum Trier zur Bundestagswahl 2025
- « Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken »
- Evangelische Akademie Bad Boll: Christsein und Politik
- Schulen als Orte der Demokratiebildung: Haltung zeigen statt Neutralität
- KDFB begrüßt Verabschiedung des Gewalthilfegesetzes
- Podcast „Durchgefallen – Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet“
- Digital und analog gegen Rassismus
- Stellungnahme der beiden Kirchen zum Zustrom-Begrenzungsgesetz (Einbringung der CDU im Deutschen Bundestag)
- Statement: Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit, fordert anlässlich der Bundestagswahl 2025, Kinderrechte ins Zentrum der Politik zu rücken
- „Mit Herz und Verstand“
- Deine Stimme für Gleichberechtigung und Demokratie – Bundestagswahl 2025
- Betzdorfer Pfadfinder planen Lichterspaziergang am 15. Januar :Zeichen für Menschlichkeit
- 108 Sternsingerinnen und Sternsinger im Bundeskanzleramt
- Brot statt Böller: Gemeinsam gegen Hunger in der Welt
- Abt Nikodemus Schnabel: „Nicht den Politikern nachplappern, sondern auf Christus hören“
- BDKJ startet Demokratieoffensive „Generation jetzt!“
- ABDA formuliert Kernpositionen zur Bundestagswahl 2025
- Ein starkes Signal für Demokratie und Nachhaltigkeit: Global Goals Klavier Nr. 16 im Deutschen Bundestag eingeweiht
- Jugendliche entwickeln Ideen für eine gerechtere Welt
- MP Schweitzer: „Den aktuellen Herausforderungen gemeinsam begegnen“ :Rheinland-Pfalz: Ministerrat trifft katholische Bischöfe
- Integrationsministerin besucht Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge der Caritas: „Von unschätzbarem Wert"
- Augustinus Forum: Trump ist zurück – Was bedeutet das für die USA und die Welt?
- Ministerpräsident Boris Rhein würdigt Engagement der Kirchen
- Frauenpower in der Politik
- Statement: Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit, mahnt nach dem Ende der Ampelkoalition, die Rechte der Kinder nicht aus den Augen zu verlieren
- 22.11.2024: Förderpreisverleihung „Verein(t) für gute Kita und Schule"
- Das youpaN fordert zusammen mit über 170 Organisationen: Bildung für nachhaltige Entwicklung zukunftsgerecht finanzieren
- MDR-Reihe „exactly“ zum Thema: „Keine Wohnung, keine Hilfe – Wie Maxim kämpft und der Staat versagt“
- Junger Dokumentarfilm 2024: Vom Leben und Umgang mit Krisen Ausstrahlung ab 7.11.2024
- Anpassungsindex von Brot für die Welt belegt wachsende Ungerechtigkeit bei Klimafinanzierung
- Der Trump-Einflüsterer
- Deutscher Apothekertag beschließt Resolution "Mehr Apotheke wagen"
- Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“: Bundesweiter Schreibwettbewerb „Die Freiheit, die ich meine…“ geht in die dritte Runde
- Freiheit, Frieden, Hoffnung und Einheit! Zehntausende singen zum Tag der Deutschen Einheit
- Mit TikTok zu mehr Wertebildung: Die Werte-Stiftung und DigitalSchoolStory starten Offensive zu stärkeren Schulgemeinschaften
- Bürgerkirche St. Gangolf: Talk mit Ackermann und Asselborn
- „Schreib die Welt nicht ab. Schreib sie um!“
- KOLPING: Tariftreue stärkt Tarifpartnerschaft
- Jetzt erst recht: Demokratie verteidigen - Stellungnahme von BAG K+R und ASF zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen
- #JungUndLaut: Euer Engagement ist preisverdächtig! - SOS-Kinderdörfer weltweit rufen zur Abstimmung für die Preise BANGER und HÄNGER auf
- Aktuell und inklusiv: MDR macht alle Wahlsendungen für Menschen mit Sinnesbehinderung barrierefrei
- Deutschland singt und klingt: Musik überwindet Mauern. Das Paneuropäische Picknick veränderte die Welt
- Wirtschaft
- Rüstung ist notwendig, aber nicht nachhaltig
- Well-Aging statt Anti-Aging
- Wird Schokolade zum Luxusgut?
- Bürokratische Entlastungen in der Pflegehilfsmittel-Versorgung für Apotheken und ihre Patienten
- 10 Millionen Euro für Niedersachsens Schulen: Besseres Lernen durch Investition in LED-Umrüstung
- Amtszeitbegrenzung und mehr Durchlässigkeit: Bundestag braucht dringend mehr Unternehmer!
- Ein besonderer Botschafter verlässt die Klinik Hohe Mark
- Interim Manager: Bauwirtschaft wird unterschätzt
- „Fachkräftemangel ist hausgemacht“: Wie Deutschland qualifizierte Zuwanderer systematisch vergrault
- Erste Degustation der Wein- und Sektprämierung Saale-Unstrut 2025
- 477 ehrenamtliche Klimaschutzpaten setzen 888 Projekte um
- Wirtschafts-Akademie warnt vor KI-Roboterwelle
- 55. Gebietsweinkönigin für die Saale-Unstrut Weinregion gesucht
- Evangelische Bank hält AAA-Rating für Hypothekenpfandbriefe
- Werte statt Geld: Immer mehr Deutsche wollen mit ihrem Erbe Gutes tun
- Klaus Tschira Stiftung stellt Fördermanagement neu auf
- Evangelische Bank schreibt 10-jährige Erfolgsgeschichte mit Höchstwerten bei Kundenvolumen und Betriebsergebnis fort
- Virale Kampagne von ROSSMANN: 200.000 Euro gegen Armut und Vereinsamung von Senioren
- Altkleider sind kein Abfall: Deutsche Kleiderstiftung ruft zu bewusster Spende auf
- Deutscher Spendenmonitor 2024: Erkenntnisse und Empfehlungen für das Bildungsengagement
- Techniker Krankenkasse unterstützt „DELPHIN-Therapie“ für stotternde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Evangelische Bank stellt im Jahr 2024 mehr als 667.000 Euro für soziale Projekte bereit
- Besserer Schutz vor Stromsperren
- Bundestagswahl: Parteien wollen Apotheken stärken, Honorierung angehen und Leistungen ausbauen
- Freiwilligentag: Mehr als 840 Mitarbeitende der TARGOBANK unterstützten 2024 über 230 gemeinnützige Organisationen
- ROSSMANN spendet Waren im Wert von rund 3 Millionen Euro an die Tafeln
- Deutscher Fundraising Preis 2025: Herausragende Fundraising-Projekte gesucht!
- stromee und iDM Wärmepumpen kooperieren für nachhaltige Heizlösungen
- BBT-Gruppe eröffnet Jubiläumsjahr „175 Jahre Barmherzige Brüder von Maria-Hilf“
- Evangelische Bank lobt EB-Nachhaltigkeitspreis 2025 aus: Gemeinsam Brücken bauen für eine nachhaltige Zukunft
- Transgourmet übernimmt Deutschlandgeschäft von PIER 7
- Thomas Preis ist neuer ABDA-Präsident und setzt Priorität auf Apothekenstärkung
- Pilgerverlag vertreibt ab sofort das Buchprogramm des „Verlagshaus Speyer“
- Bundestagswahl: Initiative "What's Apo" wirft Licht auf Gesundheitspolitik
- Jetzt für den Dietmar Heeg Medienpreis bewerben!
- „Innehalten“ – Urlaub für die Seele in Baden-Württemberg
- Zuzahlungsbefreiung für 2025 beantragen
- Nachhaltig für den Erhalt der Wirtschaftsleistung - Thorsten Luber erhält Auszeichnung für sein Engagement
- Zertifizierte Nachhaltigkeit für Arnstorfer Unternehmen
- 99 Prozent BIO – 100 Prozent Leidenschaft in Oberstdorf
- Start-Up-Hilfe: Uni Hohenheim veröffentlicht Handbuch für Gründer:innen
- Monumente des Fortschritts: Brandenburgs erstaunlichste Industriekulturorte entdecken
- Flexibler Ökostrom im Trend: stromee zieht positive Bilanz bei 30- bis 50-Jährigen und Stadtbewohnern
- ZKL beschließt Empfehlungen: Landwirtschaft der Zukunft braucht Nachhaltigkeit
- Verbraucherrechte und -pflichten: Was sich im neuen Jahr ändert
- Paketankündigung zu ihrer Sendung …
- Sozial- und Gesundheitsmanager:innen fordern neue Wege bei der Finanzierung der nachhaltigen Transformation
- Veranstaltungsbranche im Fokus - Sonderpreis für Labor Tempelhof beim 17. Deutscher Nachhaltigkeitspreis
- Sustainable Finance Award 2024: Auszeichnung für herausragende wissenschaftliche Arbeiten im Bereich nachhaltige Finanzen
- Auszeichnung für neues Austernkonzept
- 32 BIO-Zertifikate in Bronze für bayerische Jugendherbergen
- Apothekenzahl sinkt immer schneller auf 17.187
- 12. MDR-Spitzentreffen mit Behindertenverbänden: MDR baut barrierefreie Angebote im Digitalen aus – Verbände fordern auskömmliche Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
- Neuer Kreis gibt Kraftfahrern im nördlichen Rheinland-Pfalz eine Stimme: Menschenwürde gilt auch am Arbeitsplatz
- Deutscher Apothekerverband sucht innovative Apothekenprojekte
- Gemeinschaftsaktion von Christlicher Erwachsenenbildung, Aktion Arbeit im Bistum Trier und Jobcenter Merzig-Wadern:„Digi4all”: Digitale Schulungen für Jobcenter-Kunden
- Forderung an die EU-Kommission: Europa muss Kapital für soziale Investitionen mobilisieren
- Deutscher Apothekertag: Ein Jahr vor der Bundestagswahl - Apothekerschaft richtet eindringlichen Appell an die Bundesregierung
- Barrierefreies Reisen: Romantische Plätze für die Winterauszeit
- Gestern bei «Die Höhle der Löwen» (VOX) - Heute Gänsehaut für Jochen Schweizer im Palacios Podcast
- stromee führt neuen Tarif für nachhaltige Wärmestromnutzung ein
- AIV lobt Schinkel-Wettbewerb 2025 aus: „Clever aufgegleist!“
- Glaube, Liebe, Hoffnung
- JOURNAL
- KULTUR
- GET TO KNOW: Michael Kraemer
- Vom schönsten Platz Österreichs zu kulturellen Meilensteinen
- GET TO KNOW: Ben Hoffmann
- GET TO KNOW: ADRIAN
- GET TO KNOW: Thomas Lambrich
- „Deutschland schreibt ein Lied der Einheit“
- Die 8. Schweizer Autobiographie-Awards sind vergeben
- Podcast „Kopfsalat“: Einsamkeit und Schreiben
- Bio-basierte Brücke als Musikinstrument
- Wie ein Chor die Clubkultur revolutioniert: SPIELHAGEN im Interview
- Maeckes über Identität, Ehrlichkeit und seinen Umgang mit Weltschmerz - Der Musiker im Freunde fürs Leben Bar-Talk
- GET TO KNOW: Hier Kommt Nina
- GET TO KNOW: NAIR
- GET TO KNOW: Tonnen von Hall
- Für Metalheads und Fans von Hard Rock -„66,6 Metal Stories“
- Warum ein Papst die Rockmusik erfunden hat
- Garfunkel & Garfunkel "Father And Son" (TELAMO)
- King of Waltz. Queen of Music: 200 Jahre Johann Strauss in Wien
- Nina Chuba über persönliche Krisen, Therapie und Rückhalt im FRND-Bar-Talk
- Fondation Beyeler Ausstellungsprogramm 2025: Nordlichter, Träume und Unendlichkeit
- GET TO KNOW: Marla Glen
- Eine Reise durch Emotionen, Selbstfindung und tiefe Klänge: MAIVEN im Interview
- Andreas Gabalier: Mit Gaudi und G´fühl
- Roland Kaiser. Kleine Anekdoten aus dem Leben der Schlagerlegende
- Max Giesinger über Höhenflüge, Selbstzweifel und seine Therapieerfolge
- GET TO KNOW: SPIELHAGEN
- Das Schreiben und seine therapeutische Wirkung
- Marina Buzunashvilli - DIE BOSSIN
- GET TO KNOW: MAIVEN
- GET TO KNOW: Accaoui
- Adele: Über eine Popikone
- Schönherz & Fleer präsentieren das POESIE PROJEKT „Was ist Liebe“
- Festungen, Schlösser, Klöster: Barrierefreie Kulturentdeckungen im Herbst
- GET TO KNOW: CHIIARA
- Podcast „Kopfsalat“: Musik – ich singe, also spinn ich. Nicht.
- GET TO KNOW: Sina Phillips
- Segelschiffe, Entdeckertouren und Open-Air-Kultur: Barrierefreie Städtetrips im Sommer
- Rom Erleben - Reiseführer für Jugendliche
- GET TO KNOW: DANA
- GET TO KNOW: ARTEMIDES
- Hollywood-Musik made in Germany: Filmkomponist Steffen Thum im Interview
- Kinostart mit Prädikat und Empfehlung der FBW-Jugend Filmjury
- GET TO KNOW: CHRIST
- GET TO KNOW: JOSH BREAKS
- RAY – Triennale der Fotografie | Erste ECHOES Künstler*innen
- Bundesweiter Anmeldestart für Schulen: Buchgeschenke zum Welttag des Buches 2024
- Die Geschichte des Jazz als Entdeckungsreise: "Jazz und Spiritualität" von Uwe Steinmetz
- Highway Desperado", das 11. STUDIO-Album des preisgekrönten Entertainers JASON ALDEAN, ist am 03.November erschienen
- „Der Start verlief anders als geplant“ - Debütalbum von PINA BERLIN wird am 10. November veröffentlicht
- Kinostarts am 26. Oktober 2023
- Spotlight in der Dauerausstellung des Germanischen Nationalmuseums 24. Oktober 2023 bis 21. Januar 2024
- STERNE ZUM DESSERT ab 28. Dezember 2023 im Kino
- Vor fünf Jahren: Gnade spricht Gott - Amen mein Colt
- Musik, Social Media und eine gesunde Beziehung: Joelina erzählt
- Lebensgeschichte, Liebe, Schmerz und Musik: Michael Kraemer im Interview
- Mrs. Greenbird: Das neue Album "Love you to the Bone" erscheint am 8. April
- "Kommt her und esst!" - Erstkommunion-Aktion 2025
- GLAUBE, LIEBE, HOFFNUNG
- Wie Religionsunterricht Zusammenleben fördern kann
- Gott und die Schönheit
- Zum Heiligen Jahr 2025: »Alle Wege führen nach Rom« von ANDREAS ENGLISCH
- Mit Tod und Trauer umgehen und leben: "Den Schmerz umarmen"
- Künstliche Intelligenz ist eine Provokation für den Glauben | 3 Fragen an KI-Experten Michael Brendel
- Der Tod der alten Dame
- Pilgern in Vorarlberg
- Helena Steinhaus und Sabine Werth über Einsamkeit und Armut – Podcast „Kopfsalat“
- David: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen
- Vom Glauben abgefallen
- Kinostar bringt “Bonhoeffer" in die Kinos
- Mit Kindern die geheimnisvollen Rauhnächte erleben
- Raum für kleine Rituale und große Erinnerungen: Weihnachten in den SOS-Dorfgemeinschaften
- „Gott habe ihm gesagt, er solle mich zur Frau machen“ - Missbrauch in der Evangelischen Kirche – eine Einzelfallstudie
- Im Gespräch: Ein großer Auftritt dank Kardinal Lehmann
- Sport: ein starker Player für die Gesellschaft? - 5 erhellende Perspektiven
- Viele Steine bilden einen Weg
- Begeisterung - Die Kraft, die alles möglich macht
- Verzicht und Freiheit – Überlebensräume Zukunft
- Mehr als Beileid. So können wir Trauernde in schweren Zeiten begleiten
- Im Sturm lernt das Herz fliegen
- Tobias Haberl: Unter Heiden. Warum ich trotzdem Christ bleibe
- Michael Haspel: "Wer nicht liebt, steht vor dem Nichts!"
- "I still care" von Franziska Böhler
- Hadley Vlahos: Zwischen den Welten
- Rohrberger Kinder und Jugendliche lernen Franz und Klara von Assisi kennen
- Leben mit Demenz - Begleiten ohne Burnout
- Die Veredelung der Zeit
- „Laut gedacht“ mit Musiker Luvre47 – jetzt auf frnd.tv
- „Mehr als ein Job“ - Acht Frauen und Männer berichten von ihren Erfahrungen als Mitarbeitende der Diözese Würzburg
- Podcast „Kopfsalat“: Sara Doorsoun und Dr. Sharon Brehm über Liebeskummer
- Von der Symbolkraft des Wassers - Bilder und Geschichten zu Wassersegen und Brunnenbau
- Lukas Klaschinski über Gefühlsbereitschaft, das Spüren von Wut und emotionale Erfüllung
- Hat Kirche Zukunft?
- Martin Luther King. EIN LEBEN
- Ohne dich. Wenn Männer trauern
- Der Dom zu Speyer
- Mein Mann, der Alzheimer, die Konventionen und ich: »LÜCKENLEBEN« von Katrin Seyfert
- Quizbuch Bibel: Das meistgelesene Buch der Welt steckt voller Überraschungen
- Von der Reformation zur modernen Elitenherrschaft: Oliver Zimmers "Prediger der Wahrheit"
- Warum ist der Buddha so dick?
- Königlich! In Würde leben
- Vom Himmel berührt. Das Vaterunser als Übung der Achtsamkeit
- Entfeindet euch! - Auswege aus Spaltung und Gewalt
- Reich wie Buddha
- Zur Fußball-EM: Pfarrer Rainer M. Schießler erzählt seine schönsten Geschichten vom "Heiligen Rasen
- Podcast „Kopfsalat“: Erste Schritte zur Hilfe
- Der Fließweg - Interreligiös-christliche Gedanken zum Daodejing des Laozi
- Der Blick hinter den Horizont
- Und das soll man glauben? - WARUM ICH DER BIBEL TROTZDEM VERTRAUE
- 22 Fragen an dein Herz, die dein Leben mit Liebe füllen
- Mutterschaft und mentale Gesundheit: Julia Knörnschild über Wochenbettdepressionen, Tagesklinik und ADHS
- Die 6. Staffel Bar-Talk auf frnd.tv: Felix Lobrecht, Düzen Tekkal und BRKN über persönliche Herausforderungen und mentale Gesundheit
- Antisemitismus als Seismograf, um gesellschaftliche Verhältnisse zu begreifen
- Bischof Hermann Glettler (Hg.) hörgott. Gebete in den Klangfarben des Lebens - zum Jahr des Gebets 2024
- Die Juden im Koran. Ein Zerrbild mit fatalen Folgen
- "Erleuchtung kann jeder" von einem der bekanntesten deutschen spirituellen Lehrer
- SARGGESCHICHTEN. Warum selbstbestimmtes Abschiednehmen so wichtig ist
- Kirche am Ende – 16 Anfänge für das Christsein von morgen
- „Entdecke, wer dich stärkt.“: - Diaspora-Sonntag 2023
- AUS ALLER WELT
- Palma Aquarium zieht Bilanz: 2024 war ein Rekordjahr für den Meeresschutz
- Armut bekämpfen durch Hilfe zur Selbsthilfe: Erlebnisse auf den Philippinen
- Schmetterling des Jahres 2025: Die Spanische Flagge
- Neue Videos zeigen emotionale Momente einer inspirierenden Reise
- Zehn Jahre Global Micro Initiative e.V. – Ein Jahrzehnt der Chancen und Veränderungen
- Nusa Penida, Indonesien: Kleinstunternehmer durch Global Micro Initiative e.V. bereit für die Zukunft
- Die Philippinen als kulinarisches Zentrum - Der Inselstaat als Gastgeber des ersten UN Tourism Regional Forums on Gastronomy Tourism
- Global Micro Initiative e.V.: Mit internationalem Kick-off-Event ins Jubiläumsjahr
- Leben auf dem Müllberg in den Philippinen
- Mosel-Apollofalter ist Schmetterling des Jahres 2024
- 9 Jahre Global Micro Initiative e.V.: Veränderung und Hoffnung durch Mikrokredite, Schulungen und individuelle Beratungen
- „Kinder sind empfänglicher für Umweltprobleme“
- Zum Tag der Kinderrechte: Kinder haben ein Recht auf Schutz!
- China to go – Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur – 100 innovative Trends und erhellende Einblicke
- Lomboks versteckte Armut: Global Micro Initiative e.V. schafft Perspektiven
- POLITIK
- Die Kunst des kritischen Denkens und Argumentierens
- Drogenkonsumräume: 52.000 Beratungen und kein Todesfall
- KIT-Experte zu aktuellem Thema: Einfluss von KI auf demokratische Wahlen: „Um Missbrauch zu verhindern, bedarf es technologischer und rechtlicher Maßnahmen sowie Stärkung der KI-Kompetenz“
- Zur Bundestagswahl 2025: NIKOLAUS BLOMEs Debattenbuch »Falsche Wahrheiten«
- Bundestagswahl 2025: Wahlprogramme kürzer als üblich, aber immer noch schwer verständlich
- Rolle rückwärts DDR?
- The Last Beluga Whale - Betrachtungen zu einem Lied - von und mit Gert Holle
- Demokratie-Monitoring: 19 Prozent der Deutschen haben rechtspopulistisches Weltbild
- Machtübernahme
- Gier nach Privilegien - Warum uns die Politik in eine Sackgasse führt
- Europas Außengrenzen: Die Gewalt begrenzen, nicht die Menschlichkeit
- Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ feiert 75 Jahre Grundgesetz
- Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten
- Gemeinsam die Welt retten? - Vom Klimaalarm zum Green New Deal
- untertan. Von braven und rebellischen Lemmingen – Analyse unseres Opportunismus
- Vielfältig aktiv bleiben – besonders jetzt! - Wir können etwas gegen den Rechtsrutsch tun
- Die zerrissenen Staaten von Amerika
- Tausend Aufbrüche. DIE DEUTSCHEN UND IHRE DEMOKRATIE SEIT DEN 1980ER-JAHREN
- Wieso tut sich Deutschland so schwer, über Macht zu sprechen? Sophie Pornschlegel über die Zukunft der Demokratie
- JELENA KOSTJUTSCHENKO: Das Land, das ich liebe – Wie es wirklich ist, in Russland zu leben
- Landwirtschaft im Sachunterricht
- Das unvergleichliche Abitur
- Stefan Häselis Kommunikationstipps: Mehr Nähe im Alltag
- „Alt, aber sowas von lebendig» - gesagt wie im 13. Jahrhundert und keiner merkt’s!
- Schön darum-herum-geredet ist auch die Wahrheit vertuscht
- Effektive Kommunikation in herausfordernden Zeiten
- Schreiben lassen heißt auch denken lassen – erkennen Sie die Täterschaft!
- «Ein gutes, neues Jahr» – aber wie lange eigentlich?
- Lampenfieber - oder wenn die Lampe fiebert
- Konkret ist konkreter
- btw…by the way – übrigens, wo wir gerade dabei sind…
- Von Emojis und «ich glaub, du hast mich falsch verstanden»
- Oh ja…die Ferien waren wunderbar!
- Etwas Optimismus in der Sprache kann nie schaden oder besser: es nützt!
- Ein besonderes Geschenk richtig übergeben. So könnte es gelingen.
- Stimme kommt von Stimmung – stimmt!
- Machen Sie doch mal Komplimente, insbesondere da, wo es niemand vermutet!
- «Ich nicht, aber der andere auch.»
- «Ich sag dir’s nur noch einmal!»
- Der (kommunikative) Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler
- WIRTSCHAFT
- "Wer hat recht?"
- Unscripted: Wie Sie aus dem 9-to-5-Gefängnis ausbrechen, Ihr Business aufbauen und endlich frei und selbstbestimmt leben
- Verkaufstricks aus der Welt der Spionage
- Projektmanagement für inoffizielle Projektleiter
- Längst überholte Glaubenssätze überwinden mit „Women at work“ von Silke Rusch
- Welches ist das beste Girokonto?
- Mit Methoden begeistern: Die besten Tools für wirksame Lernmomente in Seminaren, Trainings und Workshops
- Ungeplante Abwesenheiten reduzieren und die Mitarbeitendenmotivation steigern
- Job Crafting - Schritt für Schritt zum Arbeitsalltag, der zu mir passt
- Zukunftstechnologie: Erneuerbare Energien
- Platz schaffen für Neues im Unternehmen: "Exnovation und Innovation"
- Positiv führt! Mit Positive Leadership Teams und Organisationen empowern
- How Big Things Get Done
- Charlie Chaplin – Erfolgsgeheimnisse einer Legende
- Kopföffner für regeneratives Wirtschaften: Re:thinking Sustainability
- Energie am Wendepunkt: Mario Weißensteiner über die Schlüsseltechnologien und Herausforderungen der nächsten Dekade
- Sicherheit für Gründer:innen im ersten Jahr mit: "Der Gründer-Cheatcode"
- Frauen können das Handwerk bunter gestalten – Bauschreinerin Mara Pischl über Frauenpower auf der Baustelle
- Mit 330 PS in ein neues Leben
- Benkos Luftschloss
- China: Schwindende Träume auf der Schnellspur
- Durchbruch
- Mythos Tankstelle. Notizen zu einer Institution in Vergangenheit und Gegenwart
- Wegweiser zu einem zeitgemäßen Entgeltsystem: "Fair Pay"
- Prompting like a Pro. KI im Verkauf erfolgreich einsetzen
- Oma wär ein verdammt guter CEO
- Massiver Fachkräftemangel in den Ingenieur- und Informatikberufen: Jährlicher Wertschöpfungsverlust liegt bei bis zu 13 Milliarden Euro
- KI in der Unternehmenspraxis
- Experte rät Firmen: Fitmachen im Sommerloch
- Mit DesignAgility die Zukunft gestalten
- Die digitale Bevormundung
- BWA: Wirtschaft erwartet „Herbst der Bürokratie“
- Drei Fragen zur Treibhausgasminderungs-Prämie
- Die Europäische Zentralbank: Herrschaft Abseits von Volkssouveränität
- 6 smarte Tipps für einen energieeffizienten Sommer
- Gemeinsam statt einsam: Raus aus der Isolation
- Deutscher Spendenmonitor: Immer mehr Menschen sind zunehmend länger auf Social Media unterwegs
- „Weltall der großen Formen“: Mit Goethe und Feininger durchs Weimarer Land
- KI-Revolution der Arbeitswelt
- Dein Turbo in die neue Medienwelt: 111 Tipps und Tricks für Instagram, Facebook, Twitter, YouTube & Co.
- "Neugierde – der zu wenig beachtete Treiber für Kreativität und Einfallsreichtum"
- Resonanz kraft Persönlichkeit: Wie Sie endlich gehört, gesehen und gelesen werden
- Der Stellar-Approach
- Urlaub und Arbeiten richtig kombinieren mit Hilfe des TaschenGuides "Workation" von Omer Dotou
- 77 magische Bilder, die dich stärker machen: Das inspirierende Motivationsbuch
- Generative Künstliche Intelligenz - ChatGPT und Co für Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft
- Science-Publikation: Schluss mit einseitiger industrieller Landwirtschaft
- Gamechanger Künstliche Intelligenz
- Nachhaltigkeit als Schlüssel für erfolgreiche Geschäftsmodelle: „Sustainability als Innovationstreiber“
- Unterschiedliche Generationen setzen beim Spenden je eigene Akzente
- Wenn der Schoko-Osterhase unerschwinglich wird
- Der Gastbeitrag: Kreativwashing
- Digital Report 2024: 23,56 Millionen Deutsche swipen etwa 38 Stunden pro Monat auf TikTok
- Soziale Arbeit für dummies
- Gastbeitrag: Mit Mathematik gegen Angst vorm Scheitern - Dr. Johanna Dahm motiviert Manager mutiger zu handeln
- Gastbeitrag: Psychologische Sicherheit: Unser Einfluss im Alltag
- Gastbeitrag: Mit Dr. Johanna Dahm Zeitenwende trotzen - Weg von 'Vielleicht' - 10 Strategien für die Zeitenwende
- DER GASTBEITRAG: Die Kunst der Verunsicherung – eine unkonventionelle Perspektive
- WISSENSCHAFT
- Vom Reststoff zum Rohstoff: Smarte Tools für eine nachhaltige Bioökonomie
- Wut-Meter: Neue Wut-Skala sagt Konfliktpotentiale am Arbeitsplatz voraus
- Treibhausgasbilanzierung 2023: Klima-Fußabdruck der Universität Hohenheim wird kleiner
- Ökologisch und sozial – aber smart: Wie Tech-Giganten Nachhaltigkeit und KI verbinden
- Agri-PV in Mooren: Solarstrom könnte Wiedervernässung attraktiver machen
- Mehr Transparenz – Kostenfallen abbauen!
- 2. New Food Festival Stuttgart: Wie Innovationen die Lebensmittelbranche revolutionieren
- Exotischer Garten: Bauarbeiten bringen neuen Glanz für grünes Juwel
- Die Energiewende verstehen: Wie Modelle Zukunft formen
- Zecken & FSME: Forschende erwarten 2025 erneut zeckenreiches Jahr
- Darmdetektive im Einsatz: DNA-Spuren entschlüsseln Ernährungsgewohnheiten
- Bundesbericht 2025 zu jungen Wissenschaftler:innen in Deutschland: Daten zu Beschäftigungsbedingungen, Karriere und Qualifizierung
- StudyCheck Award: Studierende küren Uni Hohenheim zur „Top Universität 2025“
- Resonanz schafft Perspektiven: Gelingende Beziehungen für mehr Nachhaltigkeit im Schwarzwald
- Initiative Bioökonomie: Positionspapier fordert Stärkung nachhaltiger Wirtschaft
- Projekt des Monats Januar 2025: Robustes und vielseitiges Getreide in Zeiten des Klimawandels
- European Union Prize for Citizen Science 2025: Einreichungen möglich
- Verhaltenssüchte personzentriert verstehen und behandeln
- Besondere Ehrung: Neues Bakterium trägt Namen der Universität Hohenheim
- Ausschreibung UMSICHT-Wissenschaftspreis 2025 – jetzt bewerben!
- EU-Horizon-Projekt zur Flugtüchtigkeit von Pilot*innen mit Diabetes: Forschung in der hypobaren Kammer
- „Making Medien! Coding Pädagogik?“
- Fakten, Fakes und Volksverdummung: Der Umgang mit Fehl- und Desinformation
- Mehr Nachhaltigkeit in der EU: 5 Jahre European Bioeconomy University
- Hohenheimer Lehrpreis 2024: Universität Hohenheim zeichnet exzellente Lehre aus
- Bessere Bodenqualität im Gartenbau durch Kreislaufwirtschaft
- Charlotte Bruns widmet sich der Stereofotografie
- Naseweis: Die elektronische Nase zur Bestimmung der Frische von Lebensmitteln
- Baum des Jahres 2024: Die Mehlbeere
- Tierisches Teamwork: Bienen, Fledermäuse und Vögel fördern gemeinsam die Macadamia-Produktion
- Mensch schlägt Maschine: Im direkten Wettbewerb unterliegt Kunst aus dem Computer
- Windenergie: Falschinformationen über Windräder sind weit verbreitet
- SCIENCE Publikation: Ameisen betreiben Landwirtschaft – seit 66 Millionen Jahren
- Prof. Dr. Stephan Dabbert verstorben: Uni Hohenheim erschüttert über Tod ihres Rektors
- Neue Impulse für Wissenschaftsdebatten: Ab Oktober startet das renommierte ZAK des KIT als Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) neu durch
- Weniger Treibhausgase durch Linsen- und Bohnenanbau
- Uni Hohenheim ist „Attraktivster Arbeitgeber Stuttgarts“
- Zwischen öko & konventionell: Erste Versuche mit neuem Anbausystem verlaufen erfolgreich
- „Lebe deinen Traum!“ - Felicitas Mokler macht als Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin die Geheimnisse des Universums greifbar
- Wissenschaft selbstgemacht: Uni Hohenheim lädt ein ins Schülerlabor
- Agrarforschung und Food Sciences: Uni Hohenheim bleibt Deutschlands Nr. 1 im NTU-Ranking
- Hybride Welten: Konferenz zur Interaktion zwischen Mensch und Computer
- Künstliche Intelligenz: Relevanz von Digitalkompetenz & kritischem Denken steigt
- Wohlwollende KI: Umweltmotivierte Menschen üben positiven Einfluss auf KI aus
- KI & Ernährung: Chatbots eignen sich nur bedingt für Ernährungsempfehlungen
- Automatische Spracherkennung und -übersetzung: Schnelleres Arbeiten und Lernen
- Wertschätzung: Ein Schlüssel zur Agrarwende
- Universität Hohenheim beruft fair und transparent: DHV bestätigt Gütesiegel für weitere fünf Jahre
- Früher wieder Autofahren nach Anfällen - Studie des Epilepsie-Zentrums Bethel macht Erkrankten Hoffnung
- Stark bleiben in herausfordernden Zeiten - Zuversicht kann man "lernen"
- Multitalent Stadtbaum - Gesunde Bäume für mehr Lebensqualität
- BUCHJOURNAL
- Von Tür zu Tür - Wiener Geschichten
- Die Abgelehnten
- Der alte Mann und das Geschenk des Lebens - von Leene Ehrlich
- Auf gute Nachbarschaft! Warum das Zusammenleben manchmal gar nicht so einfach ist
- Ein berührender Roman mit Sogwirkung: "So nah, so hell"
- Punkt zu Punkt: Deutschlands Schätze entdecken
- „Radikal menschlich”: Alois Prinz beleuchtet Albert Schweitzer zum 150. Geburtstag
- Gute Idee! In sieben Schritten kreativ denken lernen
- Therapie als Weg zum sinnvollen Ganzen
- Der Zauber des Berges
- Über die Herausforderungen unseres Zeitalters
- Sind wir noch zu retten?
- Lasst uns streiten! von Birte Karalus
- Die Unmöglichkeit des Lebens
- Die Katze, die nach Weisheit sucht
- CLARA. Künstlerin, Karrierefrau, Working Mom
- Zwischen Welten und Worten - Transkulturelle Übersetzungsprozesse in der Jesuitenmission des 18. Jahrhunderts bei Florian Paucke
- Fesselnde Erzählungen treffen auf wertvolle Lebensweisheiten
- Leben wie Gandhi
- 1 Jahr und 70 Dates - Eine geschiedene Buchhändlerin wagt den Sprung in den Großstadttrubel Tokios
- Trennungsangst bei Hunden
- Dalai Lama: Von Herz zu Herz - Eine Geschichte von Hoffnung und Liebe zu unserer Erde
- Für eine Kultur des Miteinanders und der Potenzialentfaltung: "Die Metamoderne"
- Alle an Bord?
- Bertha Benz und die Straße der Träume
- Frau Allerhand. Heitere Sprachspielpoesie. 116 Einreimgedichte
- Eine Welt ohne Rassismus
- Huldrychs Ende – Ein satirischer Kriminalroman von Thomas Michael Glaw
- Dein Herz, mein Herz
- Guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin
- Ermutigende Texte über Zuversicht, Nächstenliebe und Kraftquellen - Neues Buch „Entdecke, wer dich stärkt“ erscheint am 13. März
- Und dann kam Lämmchen
- Perfekte Menschen
- Schottische Highlands, Intrigen und Leidenschaft im 15. Jahrhundert: Auftakt der neuen historischen Saga über die MacKay-Schwestern
- Therapeutische Dreiecksbeziehung: Tom Sallers "Ich bin Anna" über das Schicksal der Tochter Sigmund Freuds erscheint am 21. Februar im Kanon Verlag
- KLIMAPOLITIK: DIE OPTIONEN - Von Massenverbrauch und Einzelverzicht
- Franz Kafka und sein Berufsleben: eine völlig neue Sicht auf einen der bekanntesten deutschsprachigen Autoren
- GESCHICHTE
- Geschichte von Meer und Mensch: Nikolas Jaspert, "Fischer, Perle, Walrosszahn"
- Kreisky, Israel und die Juden
- Die Bundesrepublik. Eine visuelle Geschichte
- »Die Goldene Bulle von 1356« bei wbg Theiss - Spätmittelalterliche Verfassungsgeschichte neu erzählt
- Latein: wie eine Sprache die römische Welt zusammenhielt – neu im Nünnerich-Asmus Verlag
- Die Pionierinnen. Wie Journalistinnen nach 1945 unseren Blick auf die Welt veränderten
- Jüngste Zeiten - Archäologie der Moderne in der Rhein-Ruhr-Region
- Der Stein der Weisen. Geschichte der Alchemie - Studioausstellung 27. September 2023 – 30. Juni 2024
- WOHLBEFINDEN
- Working Woman: Was ich zu Beginn meiner Karriere gerne über das Leben gewusst hätte
- Daniel Haas und Janosch Schobin über Einsamkeit und Beziehungen – Podcast „Kopfsalat“
- Die Top 10 Trends für die Fastenzeit
- Markus Kavka über Thema mentale Gesundheit im FRND-Bar-Talk
- Blasenentzündung vorbeugen
- „Hormongesteuert“: Wechseljahre-Podcast von MDR AKTUELL geht in die 3. Staffel
- Richtig atmen, besser leben
- Darmentzündungen: Intervallfasten könnte bei chronischen Erkrankungen helfen
- Jenseits der Hast: Barrierefreie Auszeiten für Naturgenießer
- Wege aus der Einsamkeit: Strategien für mehr Verbundenheit
- Warum ich keinen Alkohol mehr trinke
- Amanda Armstrong: Heilen mit dem Vagusnerv
- Was uns wirklich nährt
- "Demenz. Nicht Jetzt!" vom Demenzexperten Prof. Dr. med. Klaus Fließbach
- Projekt Lebensverlängerung
- Superkraft Vagusnerv
- Podcast Kopfsalat - Social Media und mentale Gesundheit
- Woche der Seelischen Gesundheit 2024: REDEZEIT FÜR DICH zeigt Unternehmen, wie es geht
- Gürtelrose trifft nicht nur ältere Menschen - Was die Virusinfektion begünstigt und was Betroffene dagegen tun können
- Podcast „Kopfsalat“: Migration und mentale Gesundheit
- Warum ist Schlaf so wichtig für den Körper?
- Pyjama Secrets
- Gesundheitsrisiken für Gamer: Was man tun kann, damit Mausarm & CO nicht zum Game Over werden
- Podcast „Kopfsalat“: Chronische Erkrankung und mentale Gesundheit
- Die 6 Schlüsselfaktoren für Mut, Mindset und Motivation: "Weil Erfolg nicht das ist, was du denkst" von Monika Sattler ist im Juli bei Haufe erschienen
- Viel Lärm um Achtsamkeit
- Sei neugierig!
- GESCHENKIDEEN
- KINDER + JUGEND
- Mediensucht bei Kindern – zwischen Panikmache und Realität
- Du wusstest doch, dass ich Kinder habe!
- Generation TikTok
- „Mission magisches Tagebuch“: Neue Staffel des Mental-Health-Podcasts
- Anschlag in Mannheim - So helfen Sie jetzt Ihrem Kind
- Die kleine Schnecke Monika Häuschen“ feiert Jubiläum!
- Piraten ahoi: Hier kommt Nina macht Zähneputzen zum Abenteuer im neuen Kindersong
- So schützen Eltern ihre Kinder vor Datenfallen im Netz
- Du bist nicht mehr mein Freund
- Warum sind Quallen durchsichtig?
- Die 5 No-Gos, wenn eine wichtige Prüfung ansteht
- Superkraft Wut - Ratgeber "Damit mein Kind sich besser fühlt"
- Clever mit Comics: WAS IST WAS Wissen – erstmals als Abenteuer-Comic!
- "Die Schule der magischen Tiere": Elisa und ihre Wölfin Silber fahren auf eine Waldfreizeit!
- Universal Music Family Entertainment / Karussell präsentiert: „LUCKY LUKE“ - 3 neue Originalhörspiele zu den gleichnamigen Comics in einer CD-Box!
- Klein, aber oho! Kugelspringer Schwuppdiwupp zu Gast im Garten der kleinen Schnecke Monika Häuschen und ihren Freunden!
- Reisezeit ist Lesezeit: Mit Zeitschriften im Urlaub Langeweile überbrücken und nebenbei Lesefreude wecken
- Gemeinsam gegen soziale Benachteiligung: Fernsehlotterie und Jugendherbergen sorgen mit Ferien-Camps für strahlende Kinderaugen
- Kinder und Jugendliche in Not: Psychosoziale Hilfe per Smartphone
- Sensibilisierung für Zahngesundheit – Reportage aus dem Kindergarten
- Der tapfere Pusti und seine Freunde
- Lernen sichtbar machen. Das Praxisbuch. Erfolgreich unterrichten mit dem Luuise-Verfahren
- Visible Learning 2.0
- Frische Abenteuer für große und kleine Kinder
- „Helle Sterne, dunkle Nacht" von Lisa-Viktoria Niederberger – Wissenswertes über Lichtverschmutzung für Kids ab 5
- Universal Music Family Entertainment / Karussell präsentiert die Hörspielserie: „IDEFIX UND DIE UNBEUGSAMEN“
- Auf der Zielgeraden: DEICHMANN sucht Deutschlands fitteste Grundschule
- Mit minimalem Aufwand zum 1,0-Abitur: „Bestnoten ohne Stress“ von Lara Emily Lekutat hilft Schüler*innen, schulische Ziele effizient zu erreichen
- Legasthenie und Dyskalkulie - Erste Informationen zu Lernstörungen für Kinder und Eltern
- KOCH-Ecke
- Spitzenküche für zu Hause
- Endlich kochen
- Deutsches Superfood - Nährstoffwunder aus der Heimat
- Buchtipp für die magischste Zeit des Jahres: „Das Kochbuch für die Rauhnächte“ von Patrick Rosenthal
- Die größten plant-based Ernährungs-Mythen
- Vegetarische Köstlichkeiten aus dem Airfryer
- Ribera del Duero: Weinbegleitung für das perfekte Sommer-Menü vom Grill
- Heute lieber mal vegan – Sehnsuchtsrezepte für Neugierige
- Das Trendthema Haltbarmachen in seiner ganzen Vielfalt: Grünes Kraut & Rote Beete
- BESINNLICH UND HEITER
- KULTUR
- REGIONAL
- Wir in Oberhessen
- PR-Agentur Himmel & Holle: Design + Sein
- La CAMERATA CHIARA begeistert in der Liebfrauenkirche Schotten
- Von der Diakonie-Werkstatt Wetterau zum AKTIV Werk Wetterau
- Herzlich Willkommen im Café Windrose - zeitlos am See (Schotten)
- Naturkostladen Lebenswert e.V. in Nidda
- Willkommen im Café Zeitlos im Herzen von Schotten
- Wir bieten Betreuung daheim an - Diakonie Dienstleistungen Wetterau gGmbH
- Ein Song für Dich
- KinoTraumstern und kuenstLich e.V.
- Ki-Fu® Training – von und mit Joel S. Wright
- Der Bunte Acker in Wallernhausen, eine solidarische Landwirtschaft
- Rotary Club Nidda - Gib der Welt Hoffnung
- Gerds Musikmagazin - Songs & Talks
- Yoga Nidda
- Salzbach - Die Location mit dem besonderen Charme
- Textildruck-Heilmann
- Wir in Oberhessen
- DER DENKANSTOSS
- Ein ganz normaler Tag - oder doch nicht?
- Europa bauen
- Prellböcke im Leben - 27.01.2025
- Stand up!
- Zeit ist ein Geschenk Gottes
- Es ist wunderbar - eine Weihnachtsgeschichte von und mit Gert Holle
- Ein Stück Himmel auf Erden
- Einen besseren Lebensweg suchen - Gedanken zum Buß- und Bettag von und mit Gert Holle
- Warten auf Grün
- Wenn es ernst wird ...
- Eine bessere Wahl
- Sensibel, offen, sorgfältig
- Seid mutig, wagt etwas!
- ... dann fällt Dein Blick auf Gott
- Lebensfreude schenken
- Loslassen, Mut aufbringen, vertrauen
- Wie Fische im Wasser
- Labyrinthisch eben
- ANGEDACHT
- PREDIGT
- Hörpredigt zu Ostern 2025 – Interview mit Maria
- Hörpredigt April 2025 – Eine andere Sicherheit
- Die Zeit in Gottes Händen - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Licht des Glaubens
- Gesicht zeigen – Eine christliche Besinnung von und mit Gert Holle
- Sehnsucht nach echter Freundschaft - eine Besinnung von und mit Gert Holle
- Hörpredigt März 2025 – Mir passiert das nicht
- Die Freude der Musik - eine Besinnung von und mit Gert Holle
- Erinnerungen, die uns tragen - eine Besinnung von und mit Gert Holle
- Wandel beginnt mit Umkehr - eine Besinnung von und mit Gert Holle
- LIFE - Leben in Fülle - eine Besinnung von und mit Gert Holle
- Hörpredigt Februar 2025 – Hier ist alles gratis
- FIGHT - eine Besinnung zu dem gleichnamigen Lied von Gert Holle
- 64 Squares - eine Besinnung zu dem gleichnamigen Song - von und mit Gert Holle
- "Türen öffnen – Wege ins Leben" – eine Besinnung zu dem Song OPEN THE DOOR – von und mit Gert Holle
- Besinnung zum Lied SPRECHEN ODER SCHWEIGEN - von und mit Gert Holle
- Besinnung zum Lied WE CAN LEAN ON ONE ANOTHER - von und mit Gert Holle
- Hörpredigt Januar 2025 – Bei uns alle Tage
- Ein Ort, den wir Zuhause nennen können
- Prüft alles, behaltet das Gute - eine Besinnung zu BEHIND THE CURTAIN - von und mit Gert Holle
- Hörpredigt zum Jahreswechsel 2024/25 – Jedem Anfang wohnt das Ganze inne
- Hörpredigt für Weihnachten 2024 – Vom Geheimnis Weihnachten
- „Licht in uns“ - eine Besinnung für junge Leute zu dem gleichnamigen Lied von und mit Gert Holle
- Adventliche Besinnung: TO MARS - von und mit Gert Holle
- Besinnung: In der Kälte der Nacht - von und mit Gert Holle
- Besinnung: In the Stillness of Christmas - von umd mit Gert Holle
- Hörpredigt Dezember / Advent 2024 - Freut euch!
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "HAVEN" - von und mit Gert Holle
- Hörpredigt Buß- und Bettag 2024 – Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe
- Besinnung für junge Leute zu "FIND MY PEACE" - von und mit Gert Holle
- Verantwortung, Freiheit und die Suche nach dem Licht
- Hörpredigt November 2024 - Alles wird gut
- Andacht zum Lied "I feel the Blues" von und mit Gert Holle
- Andacht zum Wochenspruch - 27. Oktober - 3. November 2024
- Andacht zum Wochenspruch - 20. - 26.10.2024
- Break the Chaines – eine Besinnung zum Welttag zur Beseitigung der Armut
- Besinnung zu dem Lied "DIFFERENT EYES" - von und mit Gert Holle
- Andacht zum Wochenspruch - 13. - 19.10.2024
- Hörpredigt Oktober 2024 – Grenzen überwinden
- Andacht zum Wochenspruch - 6. - 12. Oktober 2024
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "A VERY GOOD TIME" von und mit Gert Holle
- Hörpredigt zu Erntedank 2024 - Jesus wirft Seed-Balls
- Andacht zum Wochenspruch - 29.9. - 5.10.2024
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "LASS ES RAUS" - von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Autumnbreath" von und mit Gert Holle
- Andacht zum Wochenspruch - 22. - 28. September 2024
- Besinnung für junge Leute zu "COURAGE FOR PEACE" von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu "BREAK THE SILENCE" - von und mit Gert Holle
- Andacht zum Wochenspruch - 15. - 21. September 2024
- Besinnung für junge Leute zu "YOU ARE HIS ANGEL" - von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "WORDS" - von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Behind Excuses" - von und mit Gert Holle
- Andacht zum Wochenspruch - 8. - 14. September 2024
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Cappuccino with Cream or Foam" von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Two Hours" von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu IN DIESER ZEIT - von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Life wants you" - von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu "I'm flying to the stars tonight" - von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied HAND IM HAND THROUGH EVERY TIME - von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Who could ever forget?" von und mit Gert Holle
- Andacht zum Wochenspruch - 1. - 7. September 2024
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "SUMMERTIME" von und mit Gert Holle
- Hörpredigt September 2024 – Das Ding mit der Liebe
- IM GESPRÄCH
- DEMENZ. NICHT JETZT! - Ein Gespräch mit Prof. Dr. Klaus Fließbach
- Interview des Monats April 2025 - Gerd Schwalm spricht mit Detleff Jones
- Interview des Monats März 2025 - Gerd Schwalm spricht mit DR. DAYDOWN
- Weitere Interviews im Archiv
- Interview des Monats Februar 2025 - Gerd Schwalm spricht mit Yogi von KALLES KAVIAR
- Interview des Monats Januar 2025 - Gerd Schwalm spricht mit Rainer Thielmann
- Interview des Monats Dezember 2024 - Gerd Schwalm spricht mit Cora von "Spielhagen"
- Interview des Monats November 2024 - Gerd Schwalm spricht mit Simon Taglauer
- Interview des Monats Oktober: Gerd Schwalm spricht mit "Two Passengers"
- Interview des Monats September 2024 - Gerd Schwalm spricht mit Seth Schwarz & Lydgen, aka „ARTEMIDES“
- Interview des Monats August 2024 - Gerd Schwalm spricht mit Nina Venica von "Perlentaucher"
- Interview des Monats Juli 2024 - Gerd Schwalm spricht mit Chiiara
- Interview des Monats Juni 2024 - Gerd Schwalm spricht mit Claudia Jung
- Interview des Monats Mai 2024 - Gerd Schwalm spricht mit Nina Monschein
- Gerd Schwalm spricht mit Frieder Gutscher
- Gerd Schwalm spricht mit Markus von „Die Hammers“
- Gerd Schwalm spricht mit Andreas Hausammann
- Gerd Schwalm spricht mit Jelena Herder
- Gerd Schwalm spricht mit Werner Hucks
- Gerd Schwalm spricht mit Jonnes
- Gerd Schwalm spricht mit Daniel Kallauch
- Gerd Schwalm spricht mit Dania König
- Gerd Schwalm spricht mit Markus Kohl
- Gerd Schwalm spricht mit Chris Lass
- Gerd Schwalm spricht mit Anja Lehmann
- Gerd Schwalm spricht mit Beate Ling
- Gerd Schwalm spricht mit Christian Löer
- Gerd Schwalm spricht mit Mateo von der Band "Lux Kollektiv"
- Gerd Schwalm spricht mit Sarah Kaiser
- Gerd Schwalm spricht mit Kris Madarász
- Gerd Schwalm spricht mit Peter und Deborah Menger
- Gerd Schwalm spricht mit Addi M.
- Gerd Schwalm spricht mit Birgit Meyer
- Gerd Schwalm spricht mit Toby Meyer
- Gerd Schwalm spricht mit Adina Mitchell
- Gerd Schwalm spricht mit Chris von der Band NORMAL IST ANDERS
- Gerd Schwalm spricht mit Daniel D. Nowak
- Gerd Schwalm spricht mit Alex von den O'Bros.
- Gerd Schwalm spricht mit Mike Müllerbauer
- Gerd Schwalm spricht mit Matthias Menzel
- Gerd Schwalm spricht mit Naemi
- Gerd Schwalm sprich mit Alena Neubert
- Gerd Schwalm spricht mit Katharina Neudeck
- Gerd Schwalm spricht mit Steffi Neumann
- Gerd Schwalm spricht mit Jennifer Pepper
- Gerd Schwalm spricht mit Lars Peter
- Gerd Schwalm spricht mit David Plüss
- Gerd Schwalm spricht mit Jan Primke
- Gerd Schwalm spricht mit Simone und Gino Riccitelli
- Neue Seite
- Gerd Schwalm spricht mit Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen
- Gerd Schwalm spricht mit Peter Reimer
- Gerd Schwalm spricht mit Eberhard Rink
- Gerd Schwalm spricht mit Ute und Friedemann Rink
- Gerd Schwalm spricht mit Sebastian Rochlitzer
- Gerd Schwalm spricht mit Sam Samba
- Gerd Schwalm spricht mit Christian Schnarr
- Gerd Schwalm spricht mit Oswald Sattler
- Gerd Schwalm spricht mit Johannes Schmidt
- Gerd Schwalm spricht mit Michael Schlierf
- Gerd Schwalm spricht mit Gerhard Schnitter
- Gerd Schwalm spricht mit Stefanie Schwab
- Gerd Schwalm spricht mit Markus Schöllhorn
- Gerd Schwalm spricht mit Anna Marie Stein
- Gerd Schwalm spricht mit Thomas Steinlein
- Gerd Schwalm spricht mit der Band "Sternallee"
- Gerd Schwalm spricht mit Christoph Siemons ("SINFOGLESIA")
- Gerd Schwalm spricht mit Linda McSweeny
- Gerd Schwalm spricht mit Fabian Vogt
- Gerd Schwalm spricht mit „Peter Pan“ von „W4C“
- Gerd Schwalm spricht mit Tanja Urben
- Gerd Schwalm spricht mit Kathrin D. Weber
- Gerd Schwalm spricht mit Jürgen Werth
- Gerd Schwalm spricht mit Siegi Wilke
- Gerd Schwalm spricht mit Julie von der Band YADA Worship
- Trauer im Unternehmen - Das Schwere LEICHT gesagt
- Forum
- Service
- Gert Holle - Herausgeber und leitender Redakteur von WIR IM NETZ
- Gesund gärtnern
- Parkinson: Früherkennung und Diagnose
- Sicher auf dem Lastenrad unterwegs
- Was ändert sich mit der Heirat?
- Fahrpraxis auffrischen: Tipps für Zweiradfahrer
- Reifen richtig einlagern - Worauf Autofahrer bei Lagerung und Versicherungsschutz achten sollten
- TOP 5 Mythen zu Vitaminen
- Große Freiheit im kleinen Garten? -/ Welche Vorgaben Schrebergärtner kennen sollten
- Fünf Tipps für nachhaltiges Reisen
- Trugschlüsse im Arbeitsrecht: Was wirklich bei Kündigung, Abfindung und Urlaubsanspruch gilt
- Schutz vor Fahrraddiebstahl
- Fünf Mythen zu Antibiotika
- Fünf Mythen zum Zähneknirschen
- Täuschend echte Fälschungen - So erkennen Internetuser Deepfakes
- Wenn ein Zahn abbricht - Schnelle Hilfe für Kinder
- Fünf Mythen zum Muskelaufbau
- Der Weg zu einer erholsamen Nachtruhe
- Die fünf häufigsten Pläne für den Ruhestand
- Von der Tanne zum Trendsetter: So lebt der Weihnachtsbaum nachhaltig weiter
- Sechs Gründe für alkoholfreien Januar
- TOP 3 häufigsten Schäden am Haus im Winter
- Was bedeuten eigentlich die Zahlen auf dem Thermostat?
- 10 Top-Tipps: Gesund durch die dunkle Jahreszeit
- Frostschäden im Winter vermeiden - Wie Haus und Garten die Kälte gut überstehen
- Neuer Schutz für Neugeborene und Babys vor schwerer Atemwegserkrankung
- Sturmschäden am Auto: Wer haftet, welche Versicherung zahlt und wie sich Kfz-Besitzer vor Sturmfolgen schützen
- Unfallrisiko im Straßenverkehr: Wie Fußgänger, Rad- und E-Scooter-Fahrer sicher unterwegs sind
- Die fünf häufigsten Fragen zum Thema Kinderwunsch
- So schützt man sich bei Hitze
- App der TelefonSeelsorge als Hilfe zur Selbsthilfe bei Krisen aller Art
- Online-Bistumsatlas zeigt Orte und Aktivitäten der katholischen Kirche in Deutschland
- ADAC Notfallpass erleichtert die Rettung - Im Ernstfall können wichtige Notfalldaten über das Smartphone ausgelesen werden
- Evangelisches Onlineportal wächst weiter - Regionalzentrum kirchlicher Dienste Greifswald mit neu gestaltetem Internetauftritt auf www.kirche-mv.de
- Wie verhalte ich mich im Naturschutzgebiet?
- Pinnwand
- Schaufenster
- Blockflöte lernen mit Peter Chorkov – per Skype oder daheim in Wien!
- PR-Agentur Himmel & Holle
- Ein Ort der Inspiration und Erholung – Das Stolle-Haus in Grimma
- Katholisches Filmwerk
- La CAMERATA CHIARA
- Ein ganz persönlicher Song für Dich
- Salzbach - Die Location mit dem besonderen Charme
- Textildruck-Heilmann
- Yoga Nidda
- Angerer d. Ältere
- SITEMAP AKTUELL
- Newsletter W.I.N.
"Die andere Heilige Woche" - DOMRADIO.DE blickt in Dokumentation auf die Corona-Pandemie zurück

18.04.2025
(Köln/dr) - Leere Bänke, gespenstische Stille – und doch ein kraftvolles Zeichen des Glaubens. Fünf Jahre nach dem Beginn der Corona-Pandemie blickt DOMRADIO.DE in der Video-Dokumentation „Die andere Heilige Woche“ auf jene Tage im Frühjahr 2020 zurück, als die Kar- und Ostertage unter bislang unvorstellbaren Bedingungen – mitten im ersten Lockdown – gefeiert wurde.
Für die Verantwortlichen am Kölner Dom und im Erzbistum Köln stellte sich damals die Herausforderung, wie Gläubigen trotz geschlossener Kirchen die Mitfeier der zentralen Liturgien der Heiligen Woche ermöglicht werden konnte.

AKTUELL BEI WIR IM NETZ - SPIRITUALITÄT - 18.04.2025
Ehrenamt im Hospiz: Die Zeitschenkerin
Doku-Porträt aus der Reihe „Echtes Leben“ / ab sofort verfügbar in der ARD Mediathek und am 16. April 2025 um 23:35 Uhr im Ersten

16.04.1015
(Stuttgart/swr) - Als ehrenamtliche Sterbebegleiterin schenkt die junge Katharina todkranken Menschen ihre Zeit. Doch das Leben der Psychologiestudentin ist im Umbruch: Masterabschluss, Umzug, erster Job. Wird sie genug Kraft und Zeit finden, weiterhin andere Menschen an ihrem Lebensende zu begleiten? Die 30-minütige Doku aus der Reihe „Echtes Leben“ ist ab dem 15. April 2025 in der ARD Mediathek verfügbar und wird am 16. April 2024 um 23:35 Uhr im Ersten ausgestrahlt.
Die 25-jährige Katharina hat ein Ehrenamt, das nur wenige in ihrem Alter teilen. Sie schenkt als Sterbebegleiterin todkranken Menschen ihre Zeit. Nach der Schule erfährt sie durch einen Zeitungsartikel, dass im Hospiz Personen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) gesucht werden – zuvor war ihr nicht bewusst, dass solche Orte des Sterbens überhaupt existieren. Sie erlebt, wie sich ihr „Mindset“, wie sie selbst sagt, völlig ändert. Die Einser-Schülerin erkennt, dass es neben Lernen und Leistung auch andere Dinge gibt, die wichtig im Leben sind. Dieses Jahr prägt sie und sie entschließt sich dazu, dass ab jetzt der Tod ein fester Bestandteil ihres Lebens wird.
Im Hospiz spielt das Leben eine wichtige Rolle
Das Leben der Psychologiestudentin ist gerade im Umbruch: Sie steht kurz vor der Abgabe ihrer Masterarbeit, wird zuerst zurück zu ihren Eltern und dann in die erste eigene Wohnung ziehen, um eine zeitintensive Ausbildung zur Psychotherapeutin anzutreten. Ihr Ehrenamt tritt zurück. Doch ihr fehlen die Gespräche mit den todkranken Menschen. Wird sie in ihrem neuen Alltag zwischen Leistungsdruck und Leidenschaft genug Kraft und Zeit finden, um weiterhin Menschen an ihrem Lebensende zu begleiten?
Weitere Infos unter: http://swr.li/ehrenamt-im-hospiz-die-zeitschenkerin
„Nichts bleibt, wie es ist – die Kraft der Auferstehung Jesu Christi“
Osterbotschaft von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt
18.04.2025
In ihrer Osterbotschaft 2025 betont Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt die verbindende Kraft der Auferstehung Christi: „Jesus steht für die Wirklichkeit verändernde Macht der Liebe Gottes.“ Ostern bringe Hoffnung, Gemeinschaft und neue Perspektiven.
(Schwerin/Lübeck/dds) - In ihrer Osterbotschaft hat die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), Kristina Kühnbaum-Schmidt, die Kraft der Auferstehung als Quelle neuer Hoffnung und gelebter Gemeinschaft hervorgehoben. Die Botschaft von Ostern sei „kein lauter Triumph, sondern eine stille, verwandelnde Kraft“, so die Leitende Geistliche der Nordkirche.
Weltweite Einigkeit im Glauben
Besonders hebt die Landesbischöfin hervor, dass das Osterfest 2025 von allen christlichen Konfessionen weltweit am selben Tag gefeiert wird – ein seltenes und besonderes Ereignis. „Was für ein gutes und wichtiges Zeichen der Verbundenheit, Einigkeit und Gemeinschaft im Glauben an den auferstandenen Christus in einer so zerrissenen und gespaltenen Welt“, so Kristina Kühnbaum-Schmidt, die im Ehrenamt Vizepräsidentin des Lutherischen Weltbundes (LWB) für die Region Mittel- und Westeuropa ist.
Tränen der Trauer – und ein Neubeginn
Ausgangspunkt der diesjährigen Osterbotschaft von Kristina Kühnbaum-Schmidt ist die biblische Erzählung von Maria Magdalena am leeren Grab Jesu. Die Szene ist geprägt von Trauer und Verlorenheit – und doch verändere sich etwas Entscheidendes, als Jesus Maria beim Namen nennt, so die Landesbischöfin. „Am Klang seiner Stimme erkennt sie, dass er nicht der Gärtner ist, sondern ihr Rabbuni, ihr verehrter Lehrer“, erklärt sie und betont, in diesem Moment werde Ostern konkret: „Jesus steht zeichenhaft für die Wirklichkeit verändernde Macht der Liebe Gottes.“
Ostern als Transformation
Die Beziehung zu Jesus verändere sich durch Kreuz und Auferstehung grundlegend, erklärt Kristina Kühnbaum-Schmidt. „Jesus ist nicht mehr nur der Lehrer, der Vertraute oder Freund. Was er tut und sagt, ist nicht nur ein gutes Beispiel dafür, wie Menschen im Namen Gottes leben können und leben sollen. Sondern Jesus ist mehr als das: sein Leben, sein Sterben, seine Auferweckung, er selbst sind Heilszeichen - Jesus steht zeichenhaft für die die Wirklichkeit verändernde Macht der Liebe Gottes“, so die Landesbischöfin.
Aus Tod wird neues Leben geschaffen
Nach ihren Worten zeigt Ostern: Gottes Liebe ist bedingungslos, schöpferisch und überall gegenwärtig – selbst im Tod. „Aus Tod schafft er neues Leben, aus Vergänglichkeit Zukunft, aus Bösem Gutes“, so die Landesbischöfin. Diese Hoffnung sei keine abstrakte Idee, sondern eine konkrete Erfahrung in jedem menschlichen Leben. Kristina Kühnbaum-Schmidt betont: „Immer geht es um die Gegenwart von Gottes Liebe im konkreten Leben eines Menschen – in Ihrem, meinem, unserem Leben.“
Eine neue Gemeinschaft entsteht
Maria Magdalena sei die erste Zeugin dieser Hoffnung, erklärt die Landesbischöfin. Ihre Botschaft löse bei den Jüngern eine Bewegung aus, die eine neue, glaubende Gemeinschaft entstehen lasse – „nicht durch Abgrenzung, sondern als Hoffnungsgemeinschaft für alle Menschen“. Diese Gemeinschaft sei getragen von Vertrauen, Empathie und gegenseitiger Verantwortung, so Kristina Kühnbaum-Schmidt in ihrer Osterbotschaft 2025. „Respekt und Rücksichtnahme, Nächstenliebe, Empathie, Güte und Wohlwollen – sie sind es, die unser menschliches Zusammenleben wirklich stärken und schützen“, sagt sie.
Die Osterfrage an jede und jeden
Abschließend ruft die Landesbischöfin dazu auf, selbst mit der Botschaft der Auferstehung in Berührung zu kommen. „Ich setze darauf, dass wir an Ostern neu lernen: Nicht das, was wir haben oder womit wir andere klein machen und bedrohen können, macht uns zuversichtlich und gewiss. Sondern die Erfahrung, respektiert zu werden, die Fähigkeit, füreinander da zu sein und einander zu vertrauen, und nicht zuletzt die Liebe, die wir schenken und geschenkt bekommen. Was das konkret in Ihrem Leben heißt? Finden Sie es heraus - denn das kann uns kein anderer, keine andere abnehmen. Machen Sie Erfahrungen damit, was es heißt, andere in Ihrem Umfeld vor allem als eines anzusehen: als geliebte Geschöpfe Gottes“, so Kristina Kühnbaum-Schmidt.
Im Vertrauen darauf, dass uns Gott in eine Zukunft ruft
Ostern lade ein, sich überraschen und verwandeln zu lassen, sagt die Landesbischöfin. „Ich jedenfalls möchte mich von Ostern und der Hoffnung auf neues Leben, die die Auferweckung Christi schenkt, überraschen lassen – und ja, auch verändern, transformieren lassen. Jetzt in diesem Leben und über sein Ende hinaus - im Vertrauen darauf, dass uns Gott in eine Zukunft ruft, auch lange nach unserem Tod“, so Kristina Kühnbaum-Schmidt. Sie schließt ihre Osterbotschaft mit den Worten einer alten, österlichen Kantate: „Merke, mein Herze, beständig nur dies, Wenn du alles sonst vergisst, dass dein Heiland lebend ist; Merke, mein Herze, nur dies.“
„Wir, seine Kirche, sind Kleopas“
Osterbotschaft von Bischof Tilman Jeremias
18.04.2025
Mit seiner Osterbotschaft 2025 erinnert Bischof Tilman Jeremias daran, dass der Auferstandene uns auch dann begleitet, wenn wir ihn nicht erkennen. Ostern bedeutet neue Lebenskraft, trotz Krise.
(Greifswald/dds). - In seiner diesjährigen Osterbotschaft beschreibt Tilman Jeremias, Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), eindrucksvoll die gegenwärtige Verfasstheit der Kirche – und ihren österlichen Hoffnungskern: „Wir, seine Kirche, sind Kleopas.“ So wie der Jünger auf dem Weg nach Emmaus seien auch wir oft blind für das Leben mitten im Tod, den Trost mitten in der Krise, so Bischof Jeremias.
Auf dem Weg mit dem Unbekannten
Die biblische Szene des Osterweges steht im Mittelpunkt der Osterbotschaft von Tilman Jeremias: zwei Jünger, müde, enttäuscht und voller Trauer, auf dem Weg fort von Jerusalem. Der Bischof erkennt darin ein Bild für die Kirche in der Gegenwart – ernüchtert von Mitgliederschwund, Ressourcenknappheit und Vertrauenskrise. Doch gerade im Rückzug geschieht Unerwartetes: „Unsere Schritte werden etwas kräftiger, unser Rücken etwas aufrechter, unsere Mienen hellen sich auf“, sagt Bischof Jeremias. Es ist der Auferstandene, der unerkannt mitgeht, zuhört, spricht, die Schrift auslegt – und so langsam neues Leben weckt.
Geistliche Krise – und ein neuer Blick
Was auf den ersten Blick wie Resignation erscheint, entpuppt sich in Jeremias’ Worten als tieferer geistlicher Prozess: „Wir denken, wir hätten eine finanzielle Krise, und doch ist es eine geistliche Krise, eine Krise unseres Vertrauens.“ Der Auferstandene fordert nicht sofort sichtbare Veränderung – sondern eine neue Wahrnehmung, eine Öffnung des Herzens. Dieser österliche Moment entsteht, als der Auferstandene das Brot mit den Emmausjüngern bricht. Beim Mahl gehen ihnen die Augen auf - jetzt erreicht, dass Jesus ihnen die Schrift öffnet, ihre Herzen.
Österlicher Aufbruch – zurück in die Welt
Bischof Tilman Jeremias zeichnet ein kraftvolles Bild der Umkehr: Aus dem Rückzug wird ein neuer Aufbruch. „Dann gleich wieder los, zurück nach Jerusalem, alle sollen es hören: Er lebt! Die Beine sind leicht, wir springen, der Weg ist kurz, das Herz ist voll: Er ist wahrhaftig auferstanden“, sagt Tilman Jeremias. So wird Ostern nicht nur zum Fest, sondern zum Bewegungsimpuls – zurück in die Welt, zurück zu den Menschen, zurück ins Leben.
Ein gesegnetes Osterfest mit vielen himmlischen Momenten
Bischof Tilman Jeremias erinnert zum Schluss an das Werk des Münchner Holzschnittmeisters Walter Habdank, dass die Szene von Emmaus darstellt. „Habdank schnitzt ein österliches Lebensbild: Der Auferstandene geht in unserer Mitte, auch wenn wir ihn nicht erkennen, wenn wir noch so bedrückt sind. Wir, seine Kirche, sind gehalten und gesegnet. Ihnen ein gesegnetes Osterfest mit vielen himmlischen Momenten!“, schließt Bischof Tilman Jeremias.
Im Ende der Anfang aller Hoffnung
Die Botschaft von Landesbischöfin Heike Springhart zu Karfreitag und Ostern
18.04.2025
(Karlsruhe/ekiba) - „Die Auferstehung ist das Wunder neuer Hoffnung
in hoffnungslosen Situationen. Gott macht dem Tod ein Ende und bietet Gewalt, Morden und Folter die Stirn. Das ist die Saat der Hoffnung, die an Ostern gelegt wird“, schreibt Heike Springhart,
Bischöfin der Evangelische Landeskirche in Baden, in ihrer diesjährigen Botschaft zu Karfreitag und Ostern. Eine Hoffnung, die jeder persönlich weitergeben und leben könne. Die Osterbotschaft
2025 von Landesbischöfin Heike Springhart im Wortlaut:
„Es gibt Stille, die kaum auszuhalten ist. Das ist die Stille, die einkehrt, wenn ein Mensch gestorben und das Leben unwiderruflich zu Ende ist. Es ist die Stille, die über den Trümmern des zerbombten Krankenhauses in Gaza in den Rauchschwaden sitzt. Und die Stille, die einen ergreift beim Gang über das Gelände des Nova-Festivals und beim Blick in die Gesichter der grausam Ermordeten auf den Fotos. Es ist die Stille in den Seelen von Menschen, die durch sexualisierte Gewalt traumatisiert und zum Schweigen gebracht sind. Denen es kaum möglich ist, Worte zu finden für das, was sie ihr Leben lang belastet. Diese Stille ist die Stille des Karfreitags. An diesem Tag gedenken Christinnen und Christen der Stille auf Golgatha, nachdem Jesus Christus am Kreuz qualvoll gefoltert und den Mächten und Gewalten hingegeben gestorben ist. Schweigt Gott zu all dem, was an abgründigem Leid geschieht? Das ist die bohrende Frage seit dem Schrei des Gottessohnes am Kreuz: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Karfreitag ist der Tag, an dem das Ende aller Hoffnungen und der Blick auf die Schuld alles verstummen lässt. Deswegen läuten die Kirchenglocken an diesem Tag nicht, die Orgeln schweigen im Gottesdienst und die Kerzen werden ausgelöscht.
Kurz vor seiner Hinrichtung vor 80 Jahren, am Ende aller Hoffnung auf einen guten Ausgang der Gefangenschaft, sagte der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer: „Das ist das Ende – für mich der Beginn des Lebens.“ Dieser Satz steht zwischen Karfreitag und Ostern. Das Ende des im Widerstand Engagierten war der Tod durch den Strang. Woher kommt Hoffnung, wenn alles in Stücke bricht? Das ist die Frage, die aus der Karfreitagsstille dröhnt.
Anfang des Jahres habe ich über diese Frage mit Schülerinnen und Schülern der Schule „Talitha Kumi“ in Beit Jala im Westjordanland gesprochen. Sie hatten viel zu sagen darüber, was ihnen Hoffnung gibt: „dass wir Besuch bekommen und gesehen werden von Ihnen.“ und „dass ich meine Cousine mal wieder sehen darf.“ und „dass die Waffen gerade schweigen.“ Sie haben mir ihre Hoffnung in Form einer Vase mitgegeben, die die Form eines Granatapfels hat. Das Symbol für Auferstehung und Leben, weil er in sich das pralle Leben hat, obwohl er nach außen unscheinbar wirkt. Die Blumen, die sie mir gepflückt haben, erinnern mich auch in getrockneter und gepresster Form an die Hoffnung, die sie mir mitgegeben haben.
Am Ostermorgen kehrt das Leben zurück. Die bedrückende Stille weicht den leisen Tönen der Hoffnung. Es ist nicht die Wiederbelebung dessen, was vergangen und abgebrochen ist. Nach der Auferstehung begegnet Jesus den Seinen anders als zuvor. Deswegen erkennen sie ihn auch erst nicht. Der Evangelist Lukas erzählt von zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, die den Auferstandenen erst erkennen, als er mit ihnen das Brot bricht, obwohl ihnen schon vorher das Herz gebrannt hat im Gespräch mit ihm. Der Evangelist Johannes erzählt vom Jünger Thomas, der Jesus erst erkennt, als er den Finger in seine Wunden legt. Die Frauen, die am Ostermorgen zum Grab gehen, erschrecken erst einmal nur darüber, dass der Leichnam nicht mehr da ist. In verschiedenen Geschichten erzählt die Bibel von der Auferstehung. Alle sind hineingesprochen in Situationen von Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, Trauer und Angst. Ostern ist kein triumphales Fest. Die Auferstehung ist das Wunder neuer Hoffnung in hoffnungslosen Situationen. Gott macht dem Tod ein Ende und bietet Gewalt, Morden und Folter die Stirn. Das ist die Saat der Hoffnung, die an Ostern gelegt wird. Es ist die Hoffnung, die eine weitergibt, wenn sie den Menschen nicht links liegen lässt, der bettelnd am Straßenrand sitzt. Die Hoffnung, die der weitergibt, der im Gespräch bleibt auch mit dem, der eine andere Meinung hat. Und die Hoffnung, die eine lebt, die auch dann am Bett sitzen bleibt und die Hand hält, wenn alles zu Ende geht.
Die Wunden von Karfreitag bleiben, die Stille über den Gräbern dröhnt noch immer und die Spuren von Gewalt in den Seelen sind nicht einfach weg. Aber an Ostern bekommt die Hoffnung Raum, dass die Wunden sich verändern. Der Auferstandene ist an seinen Wunden erkennbar, aber sie haben ihre zerstörerische Kraft verloren. Am Ostermorgen kehrt das Leben zurück und Gott durchbricht die unerträgliche Stille. Das setzt allem Kriegstreiben und Großmannsgebahren ein Ende. Am Ende steht der Beginn des neuen Lebens. Und die Glocken läuten wieder.“
„Beten mit den Füßen“
Malteser aus Celle begleiteten den „Erinnerungs-Bußgang“ von Hannover nach Bergen-Belsen

16.04.2025
(Hannover/Celle/(mhd) - Es war eine Wegstrecke von 70 Kilometern und wurde zur Zeitreise von 80 Jahren: In Erinnerung an den so genannten „Todesmarsch“ von KZ-Häftlingen von Hannover-Mühlenberg in das Konzentrationslager von Bergen-Belsen im April 1945 sind Christen am Wochenende vom 11. zum 13. April 2025 einen ähnlichen Weg gelaufen. Ihr „Erinnerungs-Bußgang“ wurde begleitet von Sanitätskräften der Malteser aus Celle. Fazit nach drei Tagen Marsch: Keine medizinischen Vorkommnisse, aber tiefe menschliche Begegnungen.
Norddeutschland, April 1945: Die Front rückt näher, der „Endsieg“ der Nationalsozialisten in weite Ferne. Fast panisch räumen Nationalsozialisten die Außenlager ihrer Konzentrationslager und treiben die Häftlinge in „Todesmärschen“ in die Stammlager zurück. Am 6. und 7. April 1945 mussten rund 4.500 Männer und Frauen unter scharfer Bewachung von Hannover in das Konzentrationslager von Bergen-Belsen marschieren. Unterwegs wurden viele von ihnen ermordet.
Zuversicht schenken“

Bischof Jung feiert Kar- und Ostertage im Kiliansdom – Liveübertragungen aus dem Kiliansdom – Fußwaschung am Gründonnerstag mit Passionsspielern aus Dammbach
16.04.2025
(Würzburg/POW) - Für Christen ist die Heilige Woche von Palmsonntag bis zum Osterfest der Höhepunkt des Kirchenjahrs. Bischof Dr. Franz Jung lädt alle Gläubigen im Bistum Würzburg ein, die Liturgie besonders intensiv mitzuvollziehen. In seiner Osterbotschaft fragt Bischof Jung, was es bedeute, als „Pilger der Hoffnung“ unterwegs zu sein. Pilgern lehre, „dass wir noch nicht am Ziel sind“. Es bedeute, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, Durststrecken durchzustehen, andre mitzunehmen und von anderen mitgezogen zu werden. „Ich lade im Heiligen Jahr ausdrücklich dazu ein, einander mitzuteilen, welche Hoffnung uns erfüllt und wie sie uns hilft, den nächsten Wegabschnitt gut zu meistern. So können unsere Hoffnungsgeschichten auch denen Zuversicht schenken, die auf dem Weg erlahmen.“
Aktion zum „Tag der Diakonin +plus“ in Köln
Am 29. April demonstrieren Katholik*innen für eine gerechte Kirche
16.04.2025
(Köln/kdfb) – Er ist ein Aktions- und Empowerment-Tag: Der 29. April, Festtag der Hl. Katharina von Siena, wird seit 1998 an vielen Standorten in Deutschland zum Tag der Demonstration für eine gerechte Kirche. Der „Tag der Diakonin +plus“ steht in diesem Jahr unter dem Leitwort „Berufen. Bereit. Unaufhaltsam.“ Die zentrale Kundgebung findet in Köln statt.
Fünf Organisationen fordern gemeinsam die Öffnung des diakonischen Amtes für Frauen in der römisch-katholischen Kirche. Mehr noch: Das „+plus“ macht deutlich, dass endlich allen Menschen – unabhängig von ihrem Geschlecht – der Zugang zu allen Diensten und Ämtern in der Kirche offenstehen soll. Für die Kölner Kundgebung zeichnen das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB), die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), das Netzwerk Diakonat der Frau und erstmals auch der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) verantwortlich.
„So wie Maria Magdalena im Auftrag Jesu Christi als erste Zeugin der Auferstehung ihre Stimme erhoben hat, leben auch heute Frauen ihre Berufung – trotz Widerständen und Mauern, die vor ihnen errichtet werden“, heißt es in der Ankündigung des Aktionstages. „Am Tag der Diakonin +plus machen wir sichtbar, was längst Realität ist: Frauen übernehmen Verantwortung, leben diakonisch in Kirche und Welt. Und doch bleibt ihnen der Zugang zu den Weiheämtern verwehrt. Es ist an der Zeit, die Vielfalt von Berufungen sakramental anzuerkennen.“
Der Aktionstag beginnt um 15.00 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Roncalliplatz in Köln. Dort werden Birgit Mock (Vizepräsidentin des ZdK), Dr. Ute Zeilmann (KDFB-Vizepräsidentin), Mechthild Heil (kfd-Bundesvorsitzende), Dr. Jutta Mader-Schömer (Vorsitzende des Netzwerks Diakonat der Frau) und Katharina Geskes (Präsidium der Bundesfrauenkonferenz des BDKJ) sprechen. Die Kundgebung wird mit einem Schweigemarsch zur Kirche St. Maria im Kapitol fortgesetzt, wo um 16.30 Uhr ein Gottesdienst zum „Tag der Diakonin +plus“ stattfindet.
Alle Interessierten können sich für die Bundesveranstaltung in Köln noch bis zum 20. April anmelden unter https://bit.ly/diakonin. Ferner laden die Organisator*innen dazu ein, in Gemeinden und Gruppen in ganz Deutschland den „Tag der Diakonin +plus“ zu feiern. Eine Arbeitshilfe dazu, von KDFB und kfd erarbeitet, findet sich, zusammen mit Werbematerial für den Aktionstag, hier.
Liebe und Mitgefühl retten in Verzweiflung und Tod
Karfreitagsbotschaft von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt
16.04.2025
Liebe und Mitgefühl retten in Verzweiflung und Tod
Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt ruft in ihrer Karfreitagspredigt 2025 zum Hinschauen auf: auf das Kreuz, auf Leid, auf zerstörte Gewissheiten. Doch im Mittelpunkt steht Gottes Liebe: „Am Kreuz ist der Tod am Ende - Hoffnung wird möglich – mitten in der Dunkelheit.“
(Schwerin/dds) - In ihrer Karfreitagsbotschaft ruft die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), Kristina Kühnbaum-Schmidt, eindrücklich zur Auseinandersetzung mit dem Leiden Christi und dem Leid in der Welt auf. Sie erinnerte an die biblische Erzählung aus dem Johannesevangelium in der Jesus am Kreuz spricht: „Es ist vollbracht.“ (Johannes 19,30)
Bedrückende Spiegelbilder aktueller Wirklichkeit
„Das Kreuz ist stumm und macht stumm“, so die Leitende Geistliche der Nordkirche Die Gewalt, der Schmerz und das Leid, die Jesus am Kreuz erleidet, sind für Kristina Kühnbaum-Schmidt auch bedrückende Spiegelbilder aktueller Wirklichkeit und der Gewalt, der Menschen weltweit täglich ausgesetzt sind: „Gewalt und Tod, die ihnen von anderen Menschen gezielt und bewusst zugefügt werden. Ohne Respekt für ihr Menschenleben, ohne Mitleid, erbarmungslos.“
Beziehungen statt Einsamkeit – Das Kreuz als Ort der Verbindung
Die Landesbischöfin ruft dazu auf, sich angesichts von Hass und Gewalt resigniertem Schweigen zu verweigern. Für sie liegt in der Kreuzigung eine tiefere Dimension: Das Kreuz sei nicht der Ort endgültiger Trennung, sondern der Beginn einer neuen Gemeinschaft. „Aus dem Kreuz grünt und blüht es - aus ihm wächst neues Leben. Das Geschehen am Kreuz führt Menschen in eine neu verstandene Beziehung zu Gott und zu einer neuen Gemeinschaft zusammen“, betont die Landesbischöfin. Diese neue Gemeinschaft – so Kristina Kühnbaum-Schmidt – definiere sich nicht durch Herkunft, Zugehörigkeit oder Status, sondern durch die Beziehung zu Christus. Das Kreuz werde so zum Zentrum einer Hoffnungsgemeinschaft auch angesichts von Leid und Tod, die getragen ist von göttlicher Liebe und Mitgefühl, so die Landesbischöfin.
Ein Gott, der bleibt – mitten im Leid
Im Zentrum ihrer Botschaft steht die Gewissheit, dass Gott gerade dort gegenwärtig ist, wo aus menschlicher Perspektive alles verloren scheint. Mit dem Tod Jesu endet die Geschichte Gottes mit den Menschen nicht – sondern beginnt neu. „Auch in unserem Leben geschieht mehr, als unserem Erleben und unserer Erfahrung zugänglich ist, weil Gott auch in unserem Leben gegenwärtig ist – lebendig, wirkmächtig, rettend“, erklärt Kristina Kühnbaum-Schmidt. Damit verknüpft sie die Hoffnung auf Auferstehung mit der Gewissheit, dass auch unsere Gegenwart von Gottes schöpferischer Kraft durchdrungen ist. Die Auferweckung Jesu, so die Landesbischöfin, sei das Zeichen, dass Gottes Liebe lebendig und wirksam ist, stärker als Hass, Gewalt und Tod.
Hoffnung, die trägt – für eine menschliche, mitmenschliche Welt
Kristina Kühnbaum-Schmidt richtete ihren Blick auch auf die gegenwärtigen gesellschaftlichen Herausforderungen: die Spaltungen, die Unsicherheiten, das brüchige Vertrauen. Gegen diesen Hintergrund betonte sie die Kraft christlicher Hoffnung: „Am Kreuz ist nicht Gott am Ende, sondern der Tod.“ Diese Botschaft sei keine Vertröstung, sondern Ermutigung zum Handeln, so die Landesbischöfin. „Das Geschehen am Kreuz führt Menschen in eine neu verstandene Beziehung zu Gott und zu einer neuen Gemeinschaft zusammen. Zu einer Gemeinschaft, die durch die Beziehung zu Jesus und Gottes schöpferische Liebe geschaffen wird - eine Gemeinschaft, in der es keine Rolle spielt, woher man kommt, wer man ist oder wie viel man im Leben aufzuweisen hat. Eine Gemeinschaft, die sich nicht durch Abgrenzung und Ausgrenzung definiert, sondern als Hoffnungsgemeinschaft für alle“, sagt Kristina Kühnbaum-Schmidt und betont: „Nicht das, was wir haben oder womit wir andere klein machen und bedrohen können, macht uns zuversichtlich und gewiss. Sondern die Erfahrung, respektiert zu werden, die Fähigkeit, füreinander da zu sein und einander zu vertrauen, und nicht zuletzt die Liebe, die wir schenken und geschenkt bekommen. Lasst uns am Karfreitag neu verstehen und daraus Kraft und Zuversicht schöpfen.“
„Leiden und Befreiung verbinden uns“
Karfreitagsbotschaft von Bischof Tilman Jeremias
16.04.2025
An Karfreitag erinnert Bischof Tilman Jeremias an das Leiden Jesu – und blickt beim Pessachfest der jüdischen Gemeinde auf die Wurzeln des christlichen Glaubens: Durch Leid führt Gott zur Befreiung und zu einem neuen Anfang.
(Greifswald/Rostock/dds) - „Es war nicht das erste Mal – aber es hat mich tief berührt.“ Mit diesen Worten beschreibt Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), Tilman Jeremias, seinen Besuch beim Pessachfest der jüdischen Gemeinde in Rostock am vergangenen Samstagabend, dem ersten Abend von Pessach. In seiner Karfreitagsbotschaft schlägt der Bischof eine Brücke zwischen der Erinnerung an das Leiden Jesu und der jüdischen Befreiungserzählung vom Auszug aus Ägypten.
Sederabend: Erinnern mit allen Sinnen
„Das Sedermahl ist ein uraltes Ritual, das Jesus selbst kannte und gefeiert hat. Es führt uns zurück in die Zeit vor 2000 Jahren“, so Jeremias. Besonders bewegend war für ihn der Moment, als der Rabbiner das ungesäuerte Brot (Mazza) brach: „Da musste ich an Jesus denken – und daran, wie auch er dieses Brot mit seinen Jüngern teilte.“ Der Sederteller, gefüllt mit symbolischen Speisen, erzähle dabei mit einfachen Mitteln von Leid und Hoffnung: Bitterkräuter, in Salzwasser getaucht, stehen für die Tränen der Sklaverei. Ein kleiner Hühnerknochen erinnert an das Lamm – ein starkes Sinnbild für das Opfer Jesu.
Karfreitag und Pessach: Zwei Feste, eine Botschaft
Für Bischof Tilman Jeremias liegt die tiefere Verbindung zwischen Karfreitag und Pessach in der gemeinsamen Botschaft: „Es gibt Leid und Tod – aber Gott ist nicht fern. Er ist Befreiung, Erlösung, Neuanfang.“ Die Erinnerung an das Leiden sei nicht das Ende, sondern der Beginn von Veränderung und Hoffnung. „Wie beim Auszug aus Ägypten geht der Weg zur Befreiung durch das Leiden hindurch“, sagt Jeremias. „Auch Jesus ging diesen Weg. Und deshalb gehört der Karfreitag untrennbar zum Osterfest.“
Gemeinsame Hoffnung in einer leidvollen Welt
Mit Blick auf die Gegenwart, in der viele Menschen Leid, Krieg und Unsicherheit erleben, sieht der Bischof in der biblischen Botschaft eine Einladung: „Pessach wie Karfreitag rufen uns in Erinnerung: Gott führt uns heraus – selbst aus dem tiefsten Dunkel. Unsere Hoffnung wurzelt in dieser uralten Geschichte von Befreiung und Neubeginn. Am Ostermorgen gibt Gott Jesus ein neues Leben: Selbst in schwersten Stunden, sogar in der Finsternis eines Krieges, kann Neues beginnen. Die Welt ist durcheinander, aber Gott bleibt uns nah. Und schenkt immer wieder einen Neuanfang.“
Künstlerische Auseinandersetzung mit Trinität
Ausstellung widmet sich einer der zentralen theologischen Fragen, die damals diskutiert wurden

15.04.2025
Die neue Sonderausstellung im Museum am Dom „3:1 – Das Konzil von Nizäa und das Christusbild“ ist eröffnet worden.
Von Sabrina Birkel
(Trier/sb/bt) – Am Abend des 11. April wurde die neue Sonderausstellung „3:1 – Das Konzil von Nizäa und das Christusbild“ im Museum am Dom feierlich eröffnet. Anlässlich des 1700-jährigen Jubiläums des Konzils von Nizäa in diesem Jahr widmet sich die Ausstellung einer der zentralen theologischen Fragen, die damals diskutiert wurden: der Natur Jesu Christi.
Begrüßt wurde das Publikum vom stellvertretenden Museumsleiter Stefan Schu, der betonte, dass sich das Ausstellungskonzept an der Lichtinstallation von Künstler Philipp Schönborn orientiere – ein zentrales Gestaltungselement, das auch das Ausstellungsplakat prägt. Zudem dankte Schu allen Beteiligten ganz herzlich. Ein Grußwort sprach auch Generalvikar Dr. Ulrich von Plettenberg, der an die historische Bedeutung des Konzils erinnerte, das im Jahr 325 von Kaiser Konstantin einberufen wurde.
Trauer um Erzbischof Werner Thissen
Landesbischöfin Kühnbaum-Schmidt betont ökumenisches Engagement des Verstorbenen
16.04.2025
Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt würdigt Erzbischof em. Werner Thissen für sein ökumenisches Engagement. Thissen, der 2002 Erzbischof von Hamburg wurde, verstarb am 15. April 2025 im Alter von 86 Jahren.
(Schwerin/Hamburg/dds) - Die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) Kristina Kühnbaum-Schmidt hat mit Anteilnahme auf den Tod des früheren Erzbischof von Hamburg Dr. Werner Thissen reagiert. In einem Kondolenzschreiben an Erzbischof Dr. Stefan Heße würdigte sie Thissen als Theologen, der sich mit Engagement für die Ökumene und die öffentliche Präsenz der Kirche eingesetzt habe. Werner Thissen verstarb am 15. April 2025 im Alter von 86 Jahren in Hamburg.
Ein Brückenbauer im Norden
„In diesen Tagen der Trauer um Erzbischof em. Dr. Werner Thissen sind wir Ihnen und allen Geschwistern im Erzbistum Hamburg in herzlicher Anteilnahme, mit Mitgefühl und unserem fürbittenden Gedenken verbunden“, schrieb die Landesbischöfin an Erzbischof Heße. Sie hob hervor, dass Thissen als zweiter Erzbischof seit der Neuerrichtung des Bistums Hamburg im Jahr 1995 unter dem Leitwort „Salz im Norden“ die Entwicklung des Erzbistums und seiner Gemeinden maßgeblich vorangetrieben habe.
Ökumenisches Engagement und öffentliche Präsenz
Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt erinnerte an Thissens Engagement für die Ökumene. Mit großer Selbstverständlichkeit habe er den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2013 in Hamburg unterstützt, so die Leitende Geistliche der Nordkirche. Zudem war er in den 1990er Jahren regelmäßiger Sprecher des „Wortes zum Sonntag“ in der ARD und setzte sich für die öffentliche Sichtbarkeit der Kirche ein.
Würdigung der Lübecker Märtyrer
Ein besonderes Anliegen war Thissen die Seligsprechung der Lübecker Märtyrer. Er initiierte 2004 das Verfahren, das 2011 mit der Seligsprechung der drei katholischen Priester Hermann Lange, Eduard Müller und Johannes Prassek seinen Abschluss fand. Dabei wurde auch des evangelischen Pastors Karl Friedrich Stellbrink ehrend gedacht.
Langjähriger Weggefährte
Die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Nordkirche, Kirsten Fehrs, würdigte den Verstorbenen und dessen Verdienste um die Seligsprechung der vier Lübecker Märtyrer. „Werner Thissen war für mich ein langjähriger Weggefährte, der die Ökumene gelebt hat, theologisch pointiert und humorvoll in der Begegnung. Noch vor gut einem Jahr haben wir gemeinsam unter dem Bild des Ansgar ökumenische Gemeinschaft deutlich werden lassen. Ich bin dem Erzbistum Hamburg und den Angehörigen von Werner Thissen in diesen Stunden im Gebet verbunden“, so Kirsten Fehrs.
Ostern: Sicherheit und Gewissheit in unsicherer Zeit
Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt sieht in Osterbotschaft Grund zu Zuversicht und Geborgenheit
15.04.2025
In einer Welt voller Unsicherheit ruft Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt zu Empathie und Nächstenliebe auf, die in österlicher Hoffnung wurzeln. In ihrer Osterbotschaft warnt sie vor Populismus – und setzt auf die Kraft von Mitmenschlichkeit und Vertrauen.
(Schwerin/Neubrandenburg/(dds) - Die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) Kristina Kühnbaum-Schmidt hat in einem Namensbeitrag für die in Mecklenburg-Vorpommern erscheinenden Tageszeitungen „Nordkurier“ und „Schweriner Volkszeitung“ sowie die in Brandenburg erscheinende Tageszeitung „Der Prignitzer“ in Zeiten von Unsicherheit und Sorge vor einer gewissen Zukunft zu Empathie, Nächstenliebe und österlicher Hoffnung aufgerufen. Die Leitende Geistliche der Nordkirche reflektiert darin über das gesellschaftliche Klima in Zeiten globaler Unsicherheit. Die politischen Entwicklungen, insbesondere in den USA, seien auch hierzulande deutlich spürbar.
Zwischen Egoismus und Angst: Die Sorge um unsere Demokratie
Zusammen mit der „Angst vor Krieg und angesichts bisher politisch ungelöster Fragen“ ergebe das „ein Stimmungsgemisch, dessen Auswirkungen auf unser Zusammenleben noch nicht absehbar sind“, warnt sie. Sie befürchte, dass „eine schutzbedürftig und verletzlich erscheinende Demokratie umso mehr Stärke, Macht und Überlegenheit propagierende Populisten auf den Plan ruft. Und zwar solche, die Ausgrenzung, Drohungen und Erpressung um eigener Vorteile willen als angeblich legitime Mittel der Politik ansehen. Statt Kooperation, Verständigung und der Suche nach Kompromissen geht es dann allein um die Durchsetzung eigener Interessen - koste es, was es wolle. Jedenfalls, solange es die jeweils anderen etwas kostet.“
Gegengewicht zur Kälte: Sich dem Leid anderer nicht zu verschließen, ist etwas Göttliches
Mit Blick auf aktuelle Äußerungen zu Empathie und Mitgefühl, wie sie unter anderem vom Tech-Milliardär Elon Musk getätigt wurden, stellt Kühnbaum-Schmidt klar, dass diese beiden Haltungen keineswegs Schwäche, sondern Ausdruck tiefer Menschlichkeit und christlicher Überzeugung seien. „Mir bereitet es Sorge, dass gegenwärtig Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme auf der Strecke bleiben. Vor allem dann, wenn die für ein gutes Miteinander wichtige Empathie, also das Einfühlungsvermögen in andere, als grundlegende Schwäche diffamiert wird. Im Gegensatz dazu ist für den christlichen Glauben die Fähigkeit, sich dem Leid und dem Schmerz anderer nicht zu verschließen, geradezu etwas Göttliches“, schreibt die Landesbischöfin in ihrem Beitrag. Im Zentrum des Glaubens stehe „kein Gott, der fern und isoliert in einem wie auch immer vorgestellten Himmel thront, sondern einer, der sich als Mensch in Mitleidenschaft ziehen lässt.“ „An diesen Gott“, so Kühnbaum-Schmidt weiter, „erinnern Christen weltweit in der an diesem Sonntag beginnenden Karwoche, die im Osterfest ihren feierlichen Abschluss findet. Sie erinnern an Jesus Christus, der mit seinem Leben einstand für Liebe und Barmherzigkeit. Sein Leidensweg, seine Passion, endete in einem grausamen Tod am Kreuz - gedemütigt, gefoltert, verachtet und verspottet. Aber genau dort, wo alles hoffnungslos verloren und für immer am Ende scheint, gibt Gott dem Geschehen eine andere Wendung.“
Ostern als Quelle von Hoffnung und Zuversicht
Angesichts von Angst und Unsicherheit damals wie heute betont die Landesbischöfin die Kraft der Osterbotschaft. „Christus ist auferweckt – die alles Leben verneinende Macht des Todes hat er besiegt und überwunden. Seit damals bekennen Christen, dass Gottes Liebe stärker ist als Hass, Gewalt und Tod. Die Macht dieser Liebe zeigt sich nicht in triumphierender Stärke, Bedrohung und Gewalt. Sondern in Barmherzigkeit, Güte, Versöhnung und Frieden“, betont Kristina Kühnbaum-Schmidt. Diese Botschaft schenke Hoffnung und Zuversicht, gerade in schwierigen Zeiten. „Nicht das, was wir haben oder womit wir andere klein machen und bedrohen können, macht uns zuversichtlich und gewiss. Sondern die Erfahrung, respektiert zu werden, die Fähigkeit, füreinander da zu sein und einander zu vertrauen, und nicht zuletzt die Liebe, die wir schenken und geschenkt bekommen. Sie sind es auch, die wahren Frieden wachsen lassen - geborgen und zuversichtlich.“
Kreuzweg mit dem Drahtesel entdecken
Der Pastorale Raum Wittlich hat ihren ersten „Fahrradkreuzweg“ angeboten

15.04.2025
14 Radfahrerinnen und Radfahrer plus Vorbereitungsteam nahmen am ersten „Fahrradkreuzweg“ des Pastoralen Raum Wittlich teil.
Von Stefan Endres/red
(Wittlich/se/bt) – Unter dem Titel „Kreuz & Mehr“ hat der Pastorale Raum Wittlich erstmals einen Fahrradkreuzweg angeboten. Auf einer etwa 14 Kilometer langen Strecke rund um Wittlich bot die Tour am Tag vor Palmsonntag Gelegenheit, die katholische Tradition des Kreuzwegs Jesu neu zu entdecken und über den eigenen Lebensweg nachzudenken.
14 Radfahrerinnen und Radfahrer plus ein dreiköpfiges Vorbereitungsteam gingen bei strahlendem Sonnenschein am 12. April an den Start. Ausgangspunkt und erste Impulsstation war die Autobahn- und Radwegekirche St. Paul, an der sie der Vorsitzende des Fördervereins, Dieter Burgard, begrüßte. „Zwischen den Stationen nehmen wir uns bewusst Zeit, um das Gehörte wirken zu lassen – mehr als beim Gehen des Kreuzwegs“, sagte Pastoralreferent Ralf-Dieter Dörrenbächer zu Beginn. „Unser Leben gleicht einer Fahrt – mit Aufstiegen, Abfahrten, Gegenwind und sonnigen Momenten. Der Kreuzweg Jesu erinnert uns daran, dass er uns auf allen Wegen begleitet“, sagte er in seiner Hinführung. Es folgten zwei Bibelstellen, ein Impulstext und zwei Fragen – zum Nachdenken mitgegeben auf den Weg: „Wo erlebe ich in meinem Leben ‚durchkreuzte‘ Pläne? Gibt es eine Last, die ich nicht alleine tragen muss?“
Zeit für persönliche Gedanken gab es auf den ersten Kilometern bis zur nächsten Station an einem alten Wegekreuz kurz vor Altrich. Auf den Halt unter dem Titel „Durchkreuztes Leben“ folgten fünf weitere, die mit Bibelworten und geistlichen Texten dazu einluden, das eigene Leben in der Betrachtung des Weges Jesu zu reflektieren. Sie waren überschrieben mit „Pilger der Hoffnung“, „Prüft alles und behaltet das Gute“, „Insektenparadies – Natur“, „Glauben trotz Leid ist keine Naivität“ und dem Abschluss „Kreuz und Mehr“ an der Radwegekirche.
Ostern bedeutet: Gott schenkt immer wieder einen Neuanfang
Evangelische Kirchengemeinden in MV laden zu Gottesdiensten ein

15.04.2025
(Rostock/Stralsund/skü/cme). Ostern in Mecklenburg und Pommern: Die 329 Kirchengemeinden im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg und im Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis haben viele Vorbereitungen für die Karwoche und die Osterfesttage getroffen und laden herzlich zu Gottesdiensten und Andachten, zu Osterfeuern und Eiersuchen ein.
Die Botschaft von Ostern heißt: Gott bleibt aktiv - auch wenn es mal drunter und drüber geht. Am Ostermorgen gibt Gott Jesus ein neues Leben. Das Ostergeschehen mit Tod und Auferstehung soll uns Mut machen: Selbst im persönlichen Durcheinander, sogar in der Finsternis eines Krieges, kann Neues beginnen. Die Welt ist durcheinander, aber Gott bleibt uns nah. Und schenkt immer wieder einen Neuanfang. Darum ist das christliche Kreuz auch und vor allem ein Lebenszeichen.
Ostern ist für Christen das wichtigste Fest des Kirchenjahres, es ist zugleich das älteste christliche Fest. In den verschiedenen gottesdienstlichen Feiern der österlichen Tage Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern werden der Tod und die Auferstehung Jesu Christi vergegenwärtigt. So wird am Gründonnerstag an das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern erinnert. Am Karfreitag, dem Todestag Jesu, wird seines Leidens und Sterbens gedacht. Am Ostersonntag wird dann in festlichen Gottesdiensten die Auferstehung Jesu Christi gefeiert. Vielerorts finden in der Osternacht oder am Ostersonntag Taufen statt, da Ostern schon in der frühen Christenheit ein beliebter Tauftag war.
Mit dem Osterfest endet die Passionszeit, die Zeit der Erinnerung an die Leidensgeschichte Jesu, und es beginnt die bis einschließlich Pfingsten andauernde Osterzeit, eine Zeit der Freude. Daher wird traditionell erst nach dem Ende der Passionszeit österlich für die dann folgende Freudenzeit geschmückt.
Die Pastorinnen und Pastoren, Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen, Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen in den beiden Kirchenkreisen Mecklenburg und Pommern haben für die Gottesdienste und österlichen Feste viele besondere Höhepunkte geplant. Sie reichen von Kreuzweg-Andachten, musikalischen Gottesdiensten mit Auszügen aus der Johannespassion, über Musiken zur Sterbestunde Jesu am Karfreitag, Osterfeuern und Osterfrühstücken bis hin zu Morgenandachten. Und natürlich können in vielen Kirchengemeinden im Anschluss an die Gottesdienste am Ostersonntag die Kinder auf die Suche nach Eiern und Osternestern gehen.
Die Gottesdiensttermine und weitere Veranstaltungen in der Karwoche und zu Ostern finden sich in der lokalen Presse, direkt bei den Kirchengemeinden vor Ort oder auf den Gemeindeseiten auf dem Portal www.kirche-mv.de und insbesondere im Veranstaltungskalender unter www.kirche-mv.de/veranstaltungen
„Du gehörst doch auch zu ihm“
Bischof Ackermann lädt zu Gewissenerforschung mit der Passionsgeschichte ein

14.04.2025
Wie reagiere ich, wenn ich als Christin, als Christ angefragt werde? Zu dieser Frage regt der Bericht von der Leidensgeschichte Jesu an.
Von Judith Rupp
(Trier/bt) – Die Passionsberichte sind eine Art Gewissenerforschung für diejenigen, die sie hören: Diesen Gedanken hat Bischof Stephan Ackermann der Gottesdienstgemeinde im Trierer Dom am Palmsonntag (13. April) mit auf den Weg gegeben.
Die Passionsberichte sparten das Versagen, die Ängste und die Zweifel der Menschen in Jesu engstem Freundeskreis nicht aus. Geradezu „peinlich genau“ werde der „Tiefpunkt“, nämlich wenn Petrus leugnet, Jesus zu kennen, beschrieben: „Du warst doch auch mit ihm zusammen. Du gehörst doch auch zu diesem Jesus.“ Doch die Szene werde nicht bloß erzählt, um die Schwäche des Petrus zu dokumentieren oder „die Größe des Auferstandenen, der Petrus vergibt und ihm sogar die entstehende Kirche anvertraut“.
Bildungsmaterialien des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘ mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet
Unterrichtsbausteine zum Thema Kinderrechte werden auf dem Portal Globales Lernen mit der Bestnote bewertet
14.04.2025
(Aachen/kmw) -. Unterrichtsmaterialien des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘ zum Thema Kinderrechte sind mit der Bestnote „sehr gut“ ausgezeichnet worden. Auf dem Portal Globales Lernen, eine zentrale, bundesweite Online-Plattform zum Globalen Lernen und zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, wurden die Materialien „Kinderrechte weltweit“ mit der Note Eins bewertet. „Die Materialien unterstützen die Bereitschaft zur Solidarität und zur Übernahme von Mitverantwortung für Mensch und Umwelt und die gerechtere Gestaltung der Welt“, heißt es in der Beurteilung. Und weiter: „Die gewählten Methoden, Lern- und Arbeitstechniken sind vielfältig, sinnstiftend und zielführend. Die äußere Aufmachung ist attraktiv, zeitgemäß und lesefreundlich.“ Bewertet wurden die Materialien nach einem bestimmten Kriterienkatalog. Dazu zählten Inhalt, Didaktik und Gestaltung der Materialien.
Das Portal Globales Lernen ist eine zentrale Anlaufstelle für Lehrkräfte und Multiplikatoren, die Themen nachhaltiger Entwicklung in ihre Bildungsarbeit einbinden möchten. Zum Angebot gehören Unterrichtsmaterialien zum Download, Hinweise auf Aktionen und Kampagnen, Fortbildungsangebote und vieles mehr. Jährlich werden zahlreiche Neuerscheinungen von externen Gutachterinnen für die Aufnahme auf das Portal geprüft. Für Lehrkräfte stellen Qualitätsprüfungen dieser Art ein wichtiges Kriterium dar, um Online-Bildungsmaterialien oder Materialien von Nichtregierungsorganisationen im Unterricht einzusetzen.
Schutz, Förderung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche
Die nun mit der Bestnote ausgezeichneten Unterrichtsmaterialien des Kindermissionswerks mit dem Titel „Kinderrechte weltweit“ laden dazu ein, die Rechte von Kindern in den Blick zu nehmen und die weltweite Bedeutung von Schutz, Förderung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche zu entdecken. Die Materialien, die sich mit dem Film „Willi und die Kinderrechte“ verknüpft einsetzen lassen, führen in die Turkana nach Kenia, nach Bogotá in Kolumbien und an eine Kinderrechteschule in Deutschland. Sie bieten vertiefende Hintergründe, Methoden und Arbeitsblätter für den Unterricht in der dritten bis siebten Klasse aller Schularten.
Die Rechte von Kindern weltweit standen auch im Mittelpunkt der vergangenen Sternsingeraktion Anfang dieses Jahres. „Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte“ lautete das Motto der 67. Aktion Dreikönigssingen.
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ – das Hilfswerk der Sternsinger
Rund 1.100 Projekte für benachteiligte und Not leidende Kinder weltweit werden jährlich vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ unterstützt. Einnahmen in Höhe von insgesamt rund 71 Millionen Euro standen dem Hilfswerk der Sternsinger 2023 für seine Arbeit zur Verfügung. Gefördert wurden Projekte in 93 Ländern. Neben der Förderung der Kinder-Hilfsprojekte zählen der Einsatz für die Rechte von Kindern weltweit sowie die Bildungsarbeit zu den Aufgaben. Das Kindermissionswerk nimmt Spenden für Kinder entgegen. Spendenkonto: Pax-Bank eG, IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31, BIC: GENODED1PAX.
JO Cooper: Songs mit ganz viel Seele

14.04.2025
Der britische Soulfolks-Sänger JP Cooper hat mit seinen Hits Gold und Platin abgeräumt. Im Podcast „himmelwärts und erdverbunden“ erzählt er über seine Musik, seine Familie und seinen fest verwurzelten Glauben.
Von Christopher Hoffmann
(Trier/ch) - Der britische Soulfolk-Sänger JP Cooper hat mit seinen Songs – darunter die Top-10-Hits „Perfect Strangers“ und „September Song“ - Gold und Platin abgeräumt. Er war noch ein Baby, als seine Mutter starb; sein Vater hat ihn und seine vier Geschwister alleine durchgebracht – und ihm einen fest verwurzelten Glauben mitgegeben: „Mein Papa schreibt seit Jahren seine Gebete jeden Morgen auf. Und das mache ich jetzt auch. (…) Und ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, die für mich beten, die mir helfen und mir den Weg zeigen.“ Im Gespräch mit Christopher Hoffmann für den Podcast „himmelwärts und erdverbunden“ erzählt JP Cooper von seiner Familie, seinem Glauben – und davon, wie dankbar er ist, wenn er mit seiner Musik Menschen in guten wie in schlechten Zeiten begleiten kann.
Inklusion ist Menschenrecht!
Woche der Inklusion im Bistum Trier für Menschen mit und ohne Behinderung

12.04.2025
Vom 28. April bis 17. Mai findet zum ersten Mal die „Woche der Inklusion“ im Bistum Trier statt. Alle Angebote lassen Inklusion „im Kleinen und vor Ort“ erlebbar werden.
Von Inge Hülpes
(Bistumsweit/Trier/)– Party und Protest, Kunst und Kultur, Sport und Schlemmereien: Vom 28. April bis 17. Mai findet zum ersten Mal die „Woche der Inklusion“ im Bistum Trier statt. Anlass der vom Arbeitsfeld (AF) Inklusion im Bischöflichen Generalvikariat, der Trierischen Tonpost und der Gehörlosengemeinde initiierten Woche ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai. Auf dem Programm stehen 25 Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland plus die inklusiven Angebote im Rahmen der Heilig-Rock-Tage.
Das Osterfest 2025 auf DOMRADIO.DE digital mitfeiern
Gottesdienste der Kar- und Ostertage im Kölner Dom live im WEB-TV

(Köln/dr) - Die Weihe der Heiligen
Öle, das letzte Abendmahl, Tod und die Auferstehung Jesu Christi – diese Höhepunkte unseres christlichen Glaubens feiern wir an den Kar- und Ostertagen. DOMRADIO.DE überträgt alle
Gottesdienste live aus dem Kölner Dom:
Die Gottesdienste werden live im WEB-TV auf DOMRADIO.DE übertragen. Auch
auf YouTube,
facebook sowie
der DOMRADIO.DE-App können alle Gottesdienste mitgefeiert werden.
Auf der christlichen Streamingplattform Yesflix sind ebenfalls alle Gottesdienste von
DOMRADIO.DE zu erleben.
Bischof Tilman Jeremias: „Religionslehrkräfte geben Glaubensfragen Raum – mutig, ehrlich, dialogisch“
Nordkirche gratuliert 31 neuen Religionslehrkräften zur Vokation
12.04.2025
Mit einem Festgottesdienst in der Kirche zu Reinshagen bei Güstrow feierten 31 Religionslehrkräfte mit ihren Familien den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung. Höhepunkt des Gottesdienstes war die Verleihung der Vokationsurkunde mit Segensworten von Bischof Tilman Jeremias. Der Bischof im Sprengel würdigt den Bildungsauftrag der jungen Lehrkräfte in einer pluralen Gesellschaft.
(Schwerin / Reinshagen/dds) - Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Dorfkirche Reinshagen (bei Güstrow) hat die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) am Freitag (11. April 2025) 31 neuen Religionslehrerinnen und -lehrern die Vokation und somit die Unterrichtserlaubnis für das Fach Evangelische Religion erteilt. Der Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern Tilman Jeremias sprach den fertig ausgebildeten Fachlehrerinnen und Fachlehern für den Beginn ihrer unterrichtlichen Tätigkeit Glückwünsche und Segen zu.
Segenszusage im Gottesdienst
Begleitet wurde der Festakt durch eine dreitätige religionspädagogische Fachtagung. Thematisch stand die Frage nach religiösen Identitäten im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Weißt du, wer ich bin?“ tauschten sich die Lehrkräfte mit Expertinnen und Experten über didaktische Konzepte zu Glück und Sinn im Beruf, interreligiösen Begegnungen und Strategien gegen Antisemitismus in der Schule aus. . Die Frage nach Identität und persönlichem Glauben trifft den Nerv des schulischen Religionsunterrichts: Im Dialog lernen Schülerinnen und Schüler, über die je eigenen Werte und Glaubensansichten ins Gespräch zu kommen – mit sich selbst, mit anderen und mit Gott. Das Motto der Tagung greift dabei zugleich eine zentrale Frage Jesu aus dem Matthäusevangelium auf (Mt 16,13–20).
Mehr als Fachwissen – es geht um Haltung
„Wer evangelische Religion unterrichtet, vermittelt nicht nur Fachwissen, sondern öffnet Räume für Begegnung, Zweifel und Hoffnung. In einer Gesellschaft voller Fragen braucht es Lehrerinnen und Lehrer, die mit einer klaren Haltung und offenem Herzen unterrichten. Ich danke den nunmehr fertig ausgebildeten Lehrkräften für ihren Mut und ihren Einsatz – sie leisten einen unschätzbaren Beitrag für den Frieden, den Dialog der Religionen und die seelische Bildung junger Menschen“, so Bischof Tilman Jeremias.
Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Zerstörung des Gotischen Viertels in Wismar
Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt: „Erinnerung verpflichtet – zum Frieden, zur Demokratie, zur Mitmenschlichkeit“
12.04.2025
(Schwerin/nk) - Zum 80. Jahrestag der Zerstörung des Gotischen Viertels in Wismar mahnt Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt zu Verantwortung, Empathie und Einsatz für den Frieden. Erinnerung dürfe nicht enden – gerade in Zeiten wachsender Unsicherheit und neuer Kriege.
Schwerin/Wismar (dds). Zum Gedenken an die Bombardierung Wismars am 14. April 1945 und die Zerstörung des Gotischen Viertels der Hansestadt hat die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), Kristina Kühnbaum-Schmidt, dazu aufgerufen, das Erinnern lebendig zu halten – nicht als bloßen Rückblick, sondern als Mahnung und Auftrag. „Mögen wir im Gedenken an die Vergangenheit unsere Verantwortung für Gegenwart und Zukunft beständig wahrnehmen“, so die Leitende Geistliche der Nordkirche in ihrem Grußwort auf der Gedenkveranstaltung in der Wismarer St.-Georgen-Kirche.
Zeichen den Schmerz der Erinnerung und gleichzeitig für Hoffnung
Kristina Kühnbaum-Schmidt erinnerte an die zerstörte Stadtlandschaft Wismars, die für Leid und Verlust, aber auch für Hoffnung und Neubeginn stehe. Insbesondere die wiederaufgebaute Georgen-Kirche sei ein Zeichen „für das Gedenken, den Schmerz der Erinnerung und gleichzeitig für Hoffnung, neue Anfänge und den Wiederaufbau. Dass wir hier sind, ist Ausdruck unseres gemeinsamen Bewusstseins: für die Geschichte, für unsere Verantwortung in der Gegenwart und für die Zukunft und für Erinnern und Gedenken“, so die Landesbischöfin. Sie hob in ihren Worten hervor, wie wichtig die Fähigkeit zur Empathie ist und die Bereitschaft, „den Schmerz anderer Menschen zu teilen, sich mitfühlend zu erinnern.“
Erinnerung ist mehr als historisches Wissen
„Die Aufgabe, auch der grausamen und fassungslos machenden Kapitel unserer Geschichte zu gedenken, insbesondere derer, die mit Schuld und Verantwortung für großes Leid, für Tod und Gewalt verbunden sind, bleibt – gerade für uns als Kirche. Denn wir glauben an einen Gott, der sich nach biblischem Zeugnis seiner Schöpfung und seiner Menschheit erinnert, der gedenkt – und der für alle Menschen Versöhnung, Frieden und Hoffnung will. Und wir erinnern tröstlich auch daran, dass es weltweit Menschen gab und gibt, die sich für Frieden und Versöhnung einsetzen“, betonte Kristina Kühnbaum-Schmidt. „Gottes Erbarmen, an jedem Morgen neu, ermutigt auch uns, jeden Tag neu nach Versöhnung, Frieden und neuen Anfängen zu suchen“, so die Landesbischöfin.
Friedensauftrag in einer verletzlichen Welt
Gerade angesichts des gegenwärtigen Krieges in Europa mahnte Kühnbaum-Schmidt zum entschlossenen Handeln für Demokratie und ein friedliches Miteinander in unserem Land und in Europa. „Wir alle brauchen unsere Demokratie – aber unsere Demokratie braucht auch uns!“, erklärte sie vor den Gästen der Gedenkveranstaltung. Die Botschaft des Gedenkens müsse auch heute spürbar bleiben. „Empathie bewahrt uns vor Gleichgültigkeit und führt uns zu Mitgefühl, Solidarität und Verantwortung“, appellierte Kristina Kühnbaum-Schmidt. Aus dem Gedenken an die Vergangenheit erwachse die Verantwortung für Gegenwart und Zukunft, erklärte sie. Die Landesbischöfin würdigte insbesondere das Engagement und die kreativen Ideen der Schülerinnen und Schüler des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums an der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung und beendete ihre Ansprache mit einem Bibelwort: „Und Gott gebe seinen Segen dazu, wenn wir ihn täglich neu bitten: ‚Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens!‘“ (Lukas 1,79)
Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt: „Erinnerung verpflichtet – zum Frieden, zur Demokratie, zur Mitmenschlichkeit“
Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Zerstörung des Gotischen Viertels in Wismar
12.04.2025
(Schwerin/nk) - Zum 80. Jahrestag der Zerstörung des Gotischen Viertels in Wismar mahnt Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt zu Verantwortung, Empathie und Einsatz für den Frieden. Erinnerung dürfe nicht enden – gerade in Zeiten wachsender Unsicherheit und neuer Kriege.
Schwerin/Wismar (dds). Zum Gedenken an die Bombardierung Wismars am 14. April 1945 und die Zerstörung des Gotischen Viertels der Hansestadt hat die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), Kristina Kühnbaum-Schmidt, dazu aufgerufen, das Erinnern lebendig zu halten – nicht als bloßen Rückblick, sondern als Mahnung und Auftrag. „Mögen wir im Gedenken an die Vergangenheit unsere Verantwortung für Gegenwart und Zukunft beständig wahrnehmen“, so die Leitende Geistliche der Nordkirche in ihrem Grußwort auf der Gedenkveranstaltung in der Wismarer St.-Georgen-Kirche.
Zeichen den Schmerz der Erinnerung und gleichzeitig für Hoffnung
Kristina Kühnbaum-Schmidt erinnerte an die zerstörte Stadtlandschaft Wismars, die für Leid und Verlust, aber auch für Hoffnung und Neubeginn stehe. Insbesondere die wiederaufgebaute Georgen-Kirche sei ein Zeichen „für das Gedenken, den Schmerz der Erinnerung und gleichzeitig für Hoffnung, neue Anfänge und den Wiederaufbau. Dass wir hier sind, ist Ausdruck unseres gemeinsamen Bewusstseins: für die Geschichte, für unsere Verantwortung in der Gegenwart und für die Zukunft und für Erinnern und Gedenken“, so die Landesbischöfin. Sie hob in ihren Worten hervor, wie wichtig die Fähigkeit zur Empathie ist und die Bereitschaft, „den Schmerz anderer Menschen zu teilen, sich mitfühlend zu erinnern.“
Erinnerung ist mehr als historisches Wissen
„Die Aufgabe, auch der grausamen und fassungslos machenden Kapitel unserer Geschichte zu gedenken, insbesondere derer, die mit Schuld und Verantwortung für großes Leid, für Tod und Gewalt verbunden sind, bleibt – gerade für uns als Kirche. Denn wir glauben an einen Gott, der sich nach biblischem Zeugnis seiner Schöpfung und seiner Menschheit erinnert, der gedenkt – und der für alle Menschen Versöhnung, Frieden und Hoffnung will. Und wir erinnern tröstlich auch daran, dass es weltweit Menschen gab und gibt, die sich für Frieden und Versöhnung einsetzen“, betonte Kristina Kühnbaum-Schmidt. „Gottes Erbarmen, an jedem Morgen neu, ermutigt auch uns, jeden Tag neu nach Versöhnung, Frieden und neuen Anfängen zu suchen“, so die Landesbischöfin.
Friedensauftrag in einer verletzlichen Welt
Gerade angesichts des gegenwärtigen Krieges in Europa mahnte Kühnbaum-Schmidt zum entschlossenen Handeln für Demokratie und ein friedliches Miteinander in unserem Land und in Europa. „Wir alle brauchen unsere Demokratie – aber unsere Demokratie braucht auch uns!“, erklärte sie vor den Gästen der Gedenkveranstaltung. Die Botschaft des Gedenkens müsse auch heute spürbar bleiben. „Empathie bewahrt uns vor Gleichgültigkeit und führt uns zu Mitgefühl, Solidarität und Verantwortung“, appellierte Kristina Kühnbaum-Schmidt. Aus dem Gedenken an die Vergangenheit erwachse die Verantwortung für Gegenwart und Zukunft, erklärte sie. Die Landesbischöfin würdigte insbesondere das Engagement und die kreativen Ideen der Schülerinnen und Schüler des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums an der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung und beendete ihre Ansprache mit einem Bibelwort: „Und Gott gebe seinen Segen dazu, wenn wir ihn täglich neu bitten: ‚Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens!‘“ (Lukas 1,79)
Kirche und Jugend – stabil oder „Aura minus 1.000“?
Zahlen der Jugendabteilung im Bistum Trier sprechen deutliche Sprache

12.04.2025
82.000 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende wurden mit verschiedenen Angeboten und Aktionen erreicht. Das zeigt der jetzt veröffentlichte Jahresbericht.
Von Simone Bastreri
(Trier/Koblenz/Saarbrücken/bt) – Kirche und Jugend: Erreicht die Jahrhunderte alte Institution noch junge Leute? In der Vorstellung vieler Menschen ist die katholische Kirche ein angestaubter Verein mit altmodischen Moralvorstellungen, der im Sonntagsgottesdienst nur noch ältere Gläubige versammelt. Mit der Realität hat dieses Bild jedoch wenig zu tun, wie der jetzt veröffentlichte Jahresbericht der Jugendabteilung im Bistum Trier für 2024 zeigt: 82.000 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende wurden mit verschiedenen Angeboten und Aktionen erreicht. Und: Junge Menschen engagieren sich in kirchlichen Bereichen für andere. So haben Kinder und Jugendliche allein 40.000 Euro für die Bolivienpartnerschaft eingenommen. 359 Sternsingergruppen aus dem Bistum sammelten 2,2 Millionen Euro für Kinderhilfsprojekte auf der ganzen Welt. Ein Highlight war die 72-Stunden-Aktion, bei der 1.800 Teilnehmende von Firmlingen bis zu den Pfadfindern drei Tage lang anpackten und ein soziales oder ökologisches Projekt umsetzten. Gemeinschaft und Abenteuer erlebten auch 774 Messdiener*innen von neun bis 27 Jahren bei der Ministrantenwallfahrt nach Rom.
Abenteuer und Rätselspaß
Familienbildungsstätte Koblenz eröffnet zweiten Rätselraum

Pünktlich zu den Osterferien erweitert die Katholische Familienbildungsstätte Koblenz ihr Angebot um den neuen, spannenden Rätselraum "Insel der Stimmen"
10.04.2025
(Koblenz/bt) – Pünktlich zu den Osterferien erweitert die Katholische Familienbildungsstätte (FBS) Koblenz ihr Angebot um einen neuen, spannenden Rätselraum. Nach dem großen Erfolg des ersten Raums, in dem Familien eine Zeitreise durch Steinzeit, Antike, Mittelalter und Neuzeit erleben können, wartet nun ein weiteres Abenteuer auf Familien in der Thielenstraße 13.
In „Die Insel der Stimmen“ begeben sich Familien mit Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren auf eine geheimnisvolle, verlassene Insel. Innerhalb von 60 Minuten gilt es, knifflige Rätsel zu lösen und das große Mysterium der Insel zu entschlüsseln. Und eines ist sicher: Nur als Team können die Herausforderungen gemeistert werden.
Freude am Musizieren wecken
Sitzung des Pommerschen Kirchenkreisrats: Unterstützung für Gemeindefreizeit und Musik-Projekt / Bericht der Arbeitsstelle Ehrenamt / Impulspapiere für Beteiligungsprozess veröffentlicht
11.04.2025
(Weitenhagen/skü) - Der Kirchenkreisrat (KKR) des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises (PEK) beschloss in seiner jüngsten Sitzung, die im „Haus der Stille“ in Weitenhagen stattfand, die Gemeindefreizeit der Region „Evangelisch im Tollensewinkel“ und das Projekt „Pop auf’s Dorf“ der Kirchengemeinde Gülzowshof mit jeweils einem Zuschuss in Höhe von 500 Euro aus dem Etat „Initiativen und Projekte“ zu unterstützen. Die Region „Evangelisch im Tollensewinkel“ veranstaltet unter dem Motto „glauben, lieben, hoffen – als Christ heute leben“ eine Gemeindefreizeit im Haus „Kranich“ in Zinnowitz. Für das Projekt „Pop auf’s Dorf“ kommen professionelle Musikerinnen und Musiker im Juni in die Kirchengemeinde Gülzowshof, um mit Kindern Musikstücke einzustudieren, die zum Abschluss gemeinsam vor den Eltern und der Gemeinde aufgeführt werden. Das Projekt „Pop auf’s Dorf“ bringe Kinder und Jugendliche aus den Dörfern miteinander in Kontakt, wecke in ihnen die Freude am Musizieren und vermittle ihnen Wertschätzung für das von ihnen Dargebotene, hieß es in der Beschlussbegründung. Zudem beziehe das Projekt Menschen mit ein, die sonst keinen Kontakt zur Kirche haben.
Bericht der Arbeitsstelle Ehrenamt
Zeitweiliger Gast der Sitzung war der Referent für Ehrenamtsentwicklung im Kirchenkreis, Frithjof Nürnberger. Er berichtete dem Gremium aus seiner bisherigen, rund zweijährigen Tätigkeit. Sein Arbeitsgebiet sei im Regionalzentrum kirchlicher Dienste und Werke im Bereich Kirche und Gesellschaft angesiedelt, so Frithjof Nürnberger. „Wir verstehen uns dort als Team“, beschrieb er das gute Miteinander im Haus am Greifswalder Karl-Marx-Platz. Zentrale Anliegen seines Wirkens seien es, eine Schnittstelle im Kirchenkreis zu sein und Begegnungsräume zu schaffen, in denen sich Ehrenamtliche austauschen können. Die Organisation und Begleitung zahlreicher Weiterbildungsangebote, wie beispielsweise Kurse für Lektorinnen und Lektoren, der Kurs „Erfolgreich leiten im Ehrenamt“ oder die Ältestentage schilderte Frithjof Nürnberger den KKR-Mitgliedern als wichtige Bestandteile seiner Arbeit.
Basis der Kirchengemeinden stärken
Als große Herausforderung in der Ehrenamtsentwicklung bezeichnete Frithjof Nürnberger die Gegebenheiten im Flächenland, denen er mit einer breit aufgestellten Kommunikation und fachlich anspruchsvoll begleiteten Online-Formaten begegnet. Sein News-Letter „ehren.schnack“ erfreue sich großer Beliebtheit, auch „ehren.wert“, der Instagramkanal der Ehrenamtsstelle, stößt auf breites Interesse. Mit dem gleichnamigen Podcast, in dem er vor allem mit ehrenamtlich engagierten Menschen aus dem pommerschen Kirchenkreis ins Gespräch kommt, möchte Frithjof Nürnberger dazu beitragen, dass „die Menschen davon hören, was alles im Ehrenamt passiert.“ Denn alles stütze sich auf das Ehrenamt, ohne Ehrenamt ginge es nicht, so der Referent. Propst Tobias Sarx dankte Frithjof Nürnberger im Anschluss an dessen Bericht. „Du machst deine Arbeit großartig und wir sind froh, dass Du da bist“, so der Propst und geistlich-theologische Leiter des Regionalzentrums. In der Ehrenamtsentwicklung stecke noch viel Potential, meinte Tobias Sarx. „Die Ehrenamtsentwicklung stärkt die Basis der Kirchengemeinden. Sie ist ein wichtiger Arbeitsbereich, der ausgebaut werden sollte.“
Impulspapiere für Beteiligungsprozess veröffentlicht
Der Kirchenkreisrat blickte auf die zurückliegende Frühjahrssynode zurück, auf der vier Impulspapiere beraten wurden, die sich unter dem gemeinsamen Arbeitstitel „Zukunft im PEK“ mit künftigen Entwicklungen, Herausforderungen, Lösungsansätzen und Perspektiven in Bezug auf die vier übergeordneten Aspekte Kirchliches Leben, Kirchengemeindeverwaltung, Gebäude und Liegenschaften beschäftigen. Um einen fortgesetzten Beteiligungsprozess zu ermöglichen, sind diese Impulspapiere nun auch öffentlich auf der Internetplattform www.kirche-mv.de im Synodenbereich oder direkt unter dem Link https://www.kirche-mv.de/fileadmin/Pommern/Synode/250405_5._Tagung/Dokumente/TOP_10_Impulspapiere_Zukunft_im_PEK.pdf zugänglich.
Berufung des Internetbeirats
Ein Tagungsordnungspunkt der Sitzung war die Besetzung der drei pommerschen Plätze im Redaktionsbeirat des Internetportals www.kirche-mv.de. Der Kirchenkreisrat berief für die kommenden drei Jahre Pastor i. R. Tilman Reinecke, Arne Kühn, Geschäftsführender Referent in der Bischofskanzlei Greifswald, und Kirchenkreis-Pressesprecher Sebastian Kühl. Der Beirat setzt sich aus insgesamt sechs Mitgliedern zusammen, die paritätisch vom mecklenburgischen und vom pommerschen Kirchenkreisrat berufen werden. Der Beirat begleitet die Entwicklung des gemeinsamen Internetauftritts der Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern. Das Portal www.kirche-mv.de zählt zu den langjährigsten gemeinsamen Projekten der beiden Kirchenkreise.
Weitere Themen und nächster Sitzungstermin
Der Kirchenkreisrat verabschiedete eine Stellungnahme zum Eckpunktepapier des Zukunftsprozesses der Nordkirche „Christliche Gemeinde im Wandel gestalten“. Das Gremium befasste sich in seiner Sitzung außerdem unter anderem mit Fragen der Friedhofsverwaltung, mit Personalfragen und Stellenbesetzungen, mit einer Satzungsänderung für die Stiftung Theologisches Studienhaus, mit Immobilienfragen, mit dem anstehenden Treffen der beiden Kirchenkreisräte aus Mecklenburg und Pommern sowie mit dem aktuellen Bericht aus der Finanzabteilung.
Die nächste Zusammenkunft des pommerschen Kirchenkreisrats findet am 13. Mai 2025 statt.
Stichwort Kirchenkreisrat
Der Kirchenkreisrat vertritt den Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis in allen Angelegenheiten. Er führt die Aufsicht über die 136 Kirchengemeinden und ihre Verbände sowie über die Dienste und Werke und erteilt die erforderlichen Genehmigungen. Das Gremium besteht aus 13 Mitgliedern. Ihm gehören die drei Pröpste des Kirchenkreises, Propst Dr. Tobias Sarx (Propstei Stralsund, Dienstsitz Stralsund), Pröpstin Kathrin Kühl (Propstei Demmin, Dienstsitz Greifswald) und Propst Philipp Staak (Propstei Pasewalk, Dienstsitz Pasewalk) als geborene Mitglieder an. Die weiteren zehn Mitglieder wurden von der Synode des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises gewählt: Dr. Gerd Albrecht, Pastor Christian Bauer, Dr. Angelika Beyer, Lars Fischer, Sylvia Giesecke, Iris Heidschmidt, Bernd Klänhammer, Reinhard Kurowski, Dorothea ter Veen und Paul Witt. Vorsitzende des Kirchenkreisrats ist Pröpstin Kathrin Kühl, stellvertretende Vorsitzende ist Sylvia Giesecke. Der Kirchenkreisrat bereitet die Entscheidungen der Kirchenkreissynode vor, bringt Vorlagen ein und führt die Beschlüsse aus. Er bringt den Haushalt ein und ist für die Durchführung verantwortlich. Er berät die Pröpstin und die Pröpste, beruft die Pastorinnen und Pastoren in die Pfarrstellen des Kirchenkreises und führt die Aufsicht über die Kirchenkreisverwaltung. Der Kirchenkreisrat im Internet: http://www.kirche-mv.de/Kirchenkreisrat.565.0.html
Landessynode der Ekiba beschließt die Umsetzung weiterer Sparvorschläge
Einsparvolumen in Höhe von knapp 38 Millionen Euro bis 2032 erreicht / Priorisierung wird auf der Herbsttagung fortgesetzt
11.04.2025
(Bad Herrenalb/Karlsruhe/ekiba) -
Wie gestaltet die Evangelische Landeskirche in Baden (Ekiba) ihre Aufgaben und Angebote unter den sich ändernden finanziellen Bedingungen? Unter dem Eindruck dieser Frage fanden bis Donnerstag,
10. April, auf der Frühjahrstagung der Landessynode in Bad Herrenalb die Beratungen über den kommenden Doppelhaushalt statt. „Intensiv wurde darum gerungen, unsere Kirche zukunftsfähig
aufzustellen“, sagte Synodalpräsident Axel Wermke. „Schon im Vorfeld der Tagung war uns allen klar, dass wir hier wichtige Entscheidungen zu treffen haben, um die Lücke in den notwendigen
Sparmaßnahmen zu schließen. Im Herbst werden wir letztlich wissen, ob es uns gelingt.“
Helmut Wießner, Vorsitzender des Finanzausschusses, stellte in seinem Bericht fest: „Noch nie waren die Vorbereitungen – auch dieser Synode – so intensiv wie dieses Mal. Es ging und geht bei diesen Beratungen eben nicht nur um ein paar Eckdaten, die notwendig sind, um den nächsten Doppelhaushalt sinnvoll aufstellen zu können. Es geht auch nicht nur um die Jahre 2026 und 2027.“
Es gehe vielmehr um Priorisierungen, um Entscheidungen über eine mittel- und langfristige Perspektive. Schließlich gilt es, bis zum Jahr 2032 Einsparungen in Höhe von mindestens 50 Millionen Euro zu erzielen bei zeitgleichem Mehrbedarf unter anderem für Digitalisierung, Finanzsoftware und im Bereich Schutz vor sexualisierter Gewalt.
Zusätzlich den bereits eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von rund 23 Millionen Euro hat die Synode auf dieser Frühjahrstagung die Umsetzung weiterer Sparvorschläge in Höhe von mehr als 14 Millionen Euro beschlossen, sodass mit ihnen bis zum Jahr 2032 bereits eine Einsparung von knapp 38 Millionen Euro erzielt wird.
„Das heißt, es fehlen uns noch gut zwölf Millionen Euro pro Jahr zu dem zwingend zu erreichenden Einsparziel von 50 Millionen Euro. In den meisten Ausschüssen herrschte Konsens, dass die Synode auch noch die Möglichkeit haben muss, inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. Damit dies möglich ist, sollen statt der zwingend notwendigen 12 Millionen ca. 15 Millionen Euro pro Jahr Einsparungen erreicht werden“, berichtete Wießner. Dieser hoffentlich vorläufig letzte Schritt der Priorisierung soll auf der nächsten Herbstsynode (19. bis 23. Oktober 2025) folgen.
Die Haushaltsdefizite, die bis zum Erreichen des Einsparvolumens entstehen, sollen durch Rücklagen ausgeglichen werden. Ihren Haushalt im Jahr 2023 schloss die Evangelischen Landeskirche in Baden laut Bericht des Rechnungsprüfungsamtes mit 481,33 Millionen Euro ab und damit mit 3,42 Millionen Euro über dem Planansatz in Höhe von 484,75 Millionen Euro. Statt der geplanten 5,9 Millionen Euro mussten so lediglich 2,11 Millionen Euro aus der Haushaltssicherungsrücklage entnommen werden. Dabei waren die Kirchensteuereinnahmen mit etwa 308,8 Millionen Euro rund fünf Millionen Euro unter dem Plan geblieben – und 17,2 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert. Für die beiden Jahre werden Kirchensteuereinnahmen von rund 366 Millionen Euro pro Jahr angesetzt. Größter Ausgabenposten im kirchlichen Haushalt stellen die Personalkosten mit etwa 70 Prozent dar.
Im Bericht der Landesbischöfin hatte Heike Springhart zu Beginn der Tagungswoche die Aspekte aufgegriffen, die aus ihrer Sicht derzeit anstehen. Dabei sprach sie unter anderem über eine Kirche, die immer auch politisch ist und dabei Verständigungsorte bietet, von der Notwendigkeit in allen Gesichtern das Gesicht Jesu Christi zu entdecken, über den Umgang und die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt sowie über eine sich verändernde gastfreundliche, hoffnungsfrohe Kirche. „Weder die Wirksamkeit noch die Relevanz der Kirche hängt in erster Linie an den Mitgliedszahlen“, betonte Springhart. Dieses Wissen mache die konkreten Entscheidungen um Ressourcen nicht schmerzfreier oder einfacher, aber eine solche Haltung helfe, den Blick auf das zu bewahren, was Kirche ausmache – und auf das, was sich auch ganz anders gestalten könne. „Entscheidend bleibt, dass wir Kirche für andere und mit anderen sind, nicht für uns selbst.“
Ihre diesjährige Frühjahrstagung nutzte die Landessynode am Donnerstag zudem, um die ehemalige Oberkirchenrätin Uta Henke sowie in Abwesenheit die ehemalige Oberkirchenrätin Dr. Cornelia Weber und den ehemaligen Oberkirchenrat Urs Keller zu würdigen und zu verabschieden.
Konkret besprochen und beschlossen wurden auf dieser Frühjahrstagung unter anderem Folgendes:
Einen ersten Zwischenbericht haben die Landessynodalen zum Umbau der regionalen Verwaltungs- und Serviceämter (VSA) sowie der Evangelischen Kirchenverwaltung (EKV) erhalten, der im vergangenen Frühjahr beschlossen worden war. Ziel ist es, aus den bisher 14 VSA/EKV-Einheiten drei einheitliche Dienstleistungszentren zu bilden. Der Prozess habe seit dem Beschluss erheblich an Fahrt aufgenommen. Das Dienstleistungszentrum Süd soll bereits zum 1. Januar 2026 und die Dienstleistungszentren in der Mitte sowie im Norden zum 1. Januar 2027 in Betrieb gehen. Klar sei, dass mit der Inbetriebnahme der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Entscheidend für den Erfolg der Dienstleistungszentren für die Gemeinden und Kirchenbezirke sei unter anderem die Einführung der einheitlichen Software. Die Synodalen wiesen zudem darauf hin, dass die Vereinheitlichung der Prozesse und vor allem der Finanzierungsstruktur dringend erforderlich ist. Die Gebührenordnung für die Dienstleistungen sollen zunächst beibehalten, ehe auch sie in einem späteren Schritt vereinheitlicht werden. Für die Gemeinden soll der Service durch die Umstrukturierung nicht teurer werden.
Kirchengesetz zur Kirchenmitgliedschaft geändert
Die Landessynodalen haben mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit eine Änderung der Grundordnung beschlossen. Kern der Neuregelung zur Kirchenmitgliedschaft ist, dass ein Eintritt überall in Baden möglich sein soll, ohne dass die zuständige Parochie und deren Ältestenkreis zustimmen müssen. Zuständig für die Aufnahme sind mit Inkrafttreten der Gesetzesänderung nicht mehr die Ältestenkreise, sondern Pfarrpersonen bzw. Diakone und Diakoninnen.
Landessynode beschließt ihre Verkleinerung
Beschlossen haben die Delegierten auf dieser Frühjahrstagung auch, dass die Zahl der gewählten Landessynodalen von bisher 59 auf 55 sinkt. Damit sinkt die Gesamtgröße des Plenums von 74 auf 70 Personen. Verbunden mit dieser Reduktion ist auch eine Änderung des Wahlsystems. Unabhängig von seiner Größe wird zwar jeder Kirchenbezirk weiterhin mindestens zwei gewählte Synodale stellen. Die weiteren Wahlmandate werden anschließend aber nach dem Sainte-Laguë-Verfahren an die Kirchenbezirke entsprechend ihrer Größe vergeben. Dabei garantiert der hinterlegte Algorithmus einerseits, dass jeder Synodale dieselbe Anzahl von Kirchenmitgliedern vertritt. Andererseits ist künftig eine weitere Anpassung der Delegiertenzahl möglich, ohne dass das Wahlgesetz erneut angepasst werden müsste. Zu den 55 gewählten Delegierten der nächsten Landessynode kommen wie bisher elf berufene Mitglieder sowie vier Jugendvertreter.
Glocken- und Orgelfachberatung im Transformationsprozess gewährleistet
Die Landessynode hat beschlossen, den geplanten Wegfall einer 0,75-Stelle im Bereich der Orgel- und Glockenfachberatung um sechs Jahre auf 2032 zu verschieben. Damit soll gewährleistet werden, dass die Gemeinden im Zuge des Transformationsprozesses im Bemühen um eine nachhaltige Ausstattung ihrer Kirchen unterstützt werden können. „Es kann jetzt gut sein, dass in einer grünen Kirche eine Orgel aufwendig saniert oder sogar ersetzt werden muss, während in einer roten Kirche eine gute Orgel verkauft werden soll. Die Preise für gebrauchte Orgeln sind aber derzeit für die Verkäufer unerfreulich, weil in ganz Deutschland die gleichen Prozesse laufen und damit in größerem Umfang Orgeln auf dem Markt sind. In dieser Situation macht es sehr viel Sinn, die Beratung der Gemeinden durch fachkundige Personen im Evangelischen Oberkirchenrat aufrecht zu erhalten. Hier ist das Know-how vorhanden, um gute Orgeln und grüne Kirchen zusammenzubringen“, sagte Helmut Wießner, Vorsitzender des Finanzausschusses in seinem Bericht. „Dafür fallen dann natürlich auch Kosten an, aber es ist deutlich günstiger als die Sanierung von Orgeln bzw. der Verkauf guter Orgeln.“ Trotz der dadurch entstehenden zusätzlichen Personalkosten sei diese Lösung für die badischen Kirchen wirtschaftlich.
Drei Kirchenbezirke fusionieren
Zum 1.Januar 2026 sollen die Kirchenbezirke Adelsheim- Boxberg, Mosbach und Wertheim zum Evangelischen Kirchenbezirk Odenwald-Tauber vereinigt werden. Die Dekaninnen und Dekane der bisherigen Kirchenbezirke Adelsheim-Boxberg, Mosbach und Wertheim setzen ihre Ämter in einer gemeinsamen Zuständigkeit für den vereinigten Kirchenbezirk Odenwald-Tauber bis zum Ende ihrer Amtszeit fort. Nach Eintritt der ersten von drei Personen in den Ruhestand bleiben zwei Dekanatsstellen erhalten.
Zum 80. Todestag von Dietrich Bonhoeffer – ein Gespräch zwischen Heinrich Bedford-Strohm und Dietmar Merz

10.04.2025
(Bad Boll/abb) - "von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“
Dietrich Bonhoeffer, Brief aus der Haft, Dezember 1944
Vor 80 Jahren, am 9. April 1945, wurde der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer im KZ-Flossenbürg wegen Landes- und Hochverrats auf direkten Befehl Hitlers hingerichtet.
10.04.2025
(Paderborn/bfw) - Was möchte ich später einmal machen? Diese Frage beschäftigt viele junge Menschen. Für die Zeit nach dem Schulabschluss bietet das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken mit Sitz in Paderborn jungen Erwachsenen ab 18 Jahren die auf ein Jahr befristete Stelle eines Bundesfreiwilligendienstleistenden (m/w/d) an. Ab September 2025 können Erfahrungen für das berufliche Leben in dem international agierenden Hilfswerk gesammelt werden.
10.04.2025
(Würzburg/POW) - Bischof Dr. Franz Jung hat am Dienstag, 8. April, in Würzburg das von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Würzburg (UKAM) (www.ukam-wue.de) in Auftrag gegebene Gutachten über den Zeitraum von 1945 bis 2019 zusammen mit den hieraus abgeleiteten Empfehlungen entgegengenommen. Den Betroffenen wurde das Gutachten laut UKAM bereits vor dem Übergabetermin in einem geschützten Rahmen vorgestellt. „Ich sehe die Verbrechen und das schwere Versagen von Verantwortungsträgern in der Kirche von Würzburg. Für die Jahre des Schweigens, der Verleugnung und der Untätigkeit bitte ich um Entschuldigung – auch wenn ich ahne, dass viele dieser Bitte aus guten Gründen werden nicht entsprechen können“, sagte der Bischof in einer ersten Reaktion. Er verwies darauf, dass er am Montag, 14. April, ausführlich zum UKAM-Gutachten und den Empfehlungen Stellung nehmen werde. Diese Pressekonferenz wird live ab 10 Uhr im Kabelkanal von TV Mainfranken und auf der Homepage des Bistums Würzburg (www.bistum-wuerzburg.de) übertragen.
Prävention im Bistum Trier: kreativ, vernetzt, zielgruppenorientiert
Bistum Trier legt Jahresbericht 2024 zu Prävention, Intervention und Aufarbeitung vor

Das Bistum Trier hat seinen Rechenschaftsbericht 2024 für die Bereiche Prävention, Intervention und Aufarbeitung vorgelegt.
10.04.2025
Von Judith Rupp
(Trier/jr) – Die Kinderhomepage „grenzenzeigen.de”, Erfahrungen aus einem Methodenworkshop zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt und Sexuelle Bildung, ein Einblick in die Arbeitsgruppe zu „Missbrauch geistlicher Autorität” oder Informationen zur Möglichkeit der Akteneinsicht: All das ist im Jahresbericht 2024 zu den Aktivitäten des Bistums Trier im Bereich Prävention gegen, Intervention bei und Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt (P.I.A.) zu finden. Am 9. April 2025 hat Bischof Dr. Stephan Ackermann gemeinsam mit den Präventionsbeauftragten Angela Dieterich und Dr. Andreas Zimmer sowie der Interventionsbeauftragten Dr. Katharina Rauchenecker den Bericht vorgestellt.
Zum dritten Mal wird der Jahresbericht vorgelegt und Bischof Ackermann sieht das Bistum auf einem guten Weg: „Was mich hoffnungsvoll stimmt: Prävention ist kein Thema mehr, das mit Vorsicht und angstbehaftet behandelt wird. Prävention ist selbstverständlich geworden. Und: Prävention ist kreativ, geschieht vernetzt und zielgruppenorientiert.” Die jahrelange Präventionsarbeit trage Früchte – das bedeute jedoch nicht, „sich zurücklehnen und einen Schlussstrich ziehen zu können. Aufarbeitung geht weiter, institutionell durch die Unabhängige Aufarbeitungskommission (UAK) im Bistum Trier wie individuell. Wir lernen aus den Erkenntnissen der Zwischenberichte und Studien und arbeiten daran, die Empfehlungen der UAK konsequent umzusetzen”.
Auf den Spuren einer Heiligen
Pilgerbegleitung auf dem Hildegardweg bietet Mehrwert für alle Interessierten

8.04.2025
Pilgern ist für viele Menschen mit Wegen in Spanien oder Italien verbunden, doch Pilgern geht auch im Bistum Trier.
Von Julia Fröder
(Bad Kreuznach/jf) – „Ich bin dann mal weg“, der Bestseller von Hape Kerkeling ist zwar schon fast 20 Jahre alt, aber der Trend des Pilgerns ist ungebrochen. Doch nicht nur im fernen Spanien gibt es interessante und anspruchsvolle Strecken, sondern auch vor der Haustür: Der Hildegard-von-Bingen-Pilgerwanderweg führt von Idar-Oberstein bis Bingerbrück. Wer die Strecke oder Abschnitte davon mit einem „Mehr“ an Informationen, Impulsen und Gemeinschaft erleben möchte, ist bei Pilgerbegleiterinnen und Pilgerbegleitern wie Elisabeth Hamburger und Anja Weyer genau richtig.
70 jähriges Bestehen des Leo Baeck Instituts, Festjahr unter Schirmherrschaft des Bundepräsidenten
9.04.2025
(Berlin/lbi) - Das Leo Baeck Institut feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen mit einem Festjahr unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Die zentrale Jubiläumsveranstaltung findet am 17. Juni in Berlin statt. Die Festrede hält der Schriftsteller Doron Rabinovici.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betont anlässlich der Übernahme seiner Schirmherrschaft die unschätzbar wertvolle Arbeit des Leo Baeck Instituts zur internationalen Erforschung und Vermittlung deutsch-jüdischer Geschichte und Kultur und würdigt deren Einsatz für die Bewahrung dieses bedeutenden Teils deutscher Geschichte sowie für den interkulturellen Austausch:
"Leo Baeck, und das ist sein Vermächtnis, war ein Versöhner: zwischen den Religionen und Kulturen, zwischen Christen und Juden in Deutschland". Darüber hinaus bekräftigt der Bundespräsident seine Wertschätzung und Unterstützung des Instituts, denn "unsere Verantwortung vor der Geschichte ist Teil unserer Identität. Sie kennt keinen Schlussstrich und keine Relativierung."
Prof. Dr. Michael Brenner, internationaler Präsident des Leo Baeck Instituts erklärt dazu: "Wir sind dankbar für diese Anerkennung unserer Arbeit. Die Geschichte zu bewahren und die Relevanz der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft aufzuzeigen, ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Die deutsch-jüdische Geschichte wirft immer wieder neue Fragen auf".
Das Festjahr steht unter dem Motto "LBI at 70 - Bridging Generations." und wird von zahlreichen Projekten und Veranstaltungen in Israel, Großbritannien, den USA und Deutschland begleitet. So findet im Vorfeld des Festaktes im Schloss Glienicke (Berlin/Potsdam) vom 7.-9. Mai die Konferenz "80 Jahre Kriegsende - Jüdische Perspektiven auf Neuanfänge nach 1945" statt, die von der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft des Leo Baeck Instituts veranstaltet wird.
Das Leo Baeck Institut ist heute eine der weltweit größten unabhängigen jüdischen Forschungseinrichtungen. Es wurde 1955 von deutschsprachigen, jüdischen Emigrierten gegründet. Zu den Gründungsvätern und -müttern gehörten etwa Hannah Arendt, Martin Buber, Selma Stern und Robert Weltsch. Sie wollten das lebendige kulturelle Erbe des deutschsprachigen Judentums bewahren, dem sie selbst entstammten und das im Holocaust nahezu vollständig vernichtet wurde. Namensgeber und erster Präsident des Instituts war der Rabbiner Leo Baeck, der letzte Repräsentant des deutschen Judentums im Nationalsozialismus. Das Leo Baeck Institut entstand als Ort der lebendigen Erinnerung mit drei unabhängigen Forschungszentren in Jerusalem, London und New York. Durch seine drei Standorte agiert es seit jeher transnational, interkulturell und brückenbauend. Es beherbergt eines der umfangreichsten Archive zum deutschsprachigen Judentum und der deutsch-jüdischen Diaspora und trägt aktiv zur lebendigen Erinnerungskultur bei.
Weitere Informationen unter www.lbi-70.org